Unternehmen müssen bis 2025 Ladeinfrastruktur umsetzen. Förderungen und Finanzierungsmodelle helfen bei der Umsetzung der GEIG-Vorgaben.

Ab 2025 gelten neue Vorschriften für Ladeinfrastruktur in Unternehmen. Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) verpflichtet Unternehmen, Ladepunkte bereitzustellen, insbesondere in Gebäuden mit mehr als 20 Stellplätzen. Gleichzeitig gibt es Förderprogramme, die die Kosten für Anschaffung und Betrieb reduzieren können. Unternehmen müssen zwischen Kauf (CAPEX) und Miete (OPEX) der Ladeinfrastruktur entscheiden und ein passendes Betreibermodell wählen – entweder eigenständig oder durch einen Charge Point Operator (CPO).
Jetzt handeln: Frühzeitige Planung und Nutzung von Förderprogrammen sind entscheidend, um Kosten zu sparen und gesetzliche Vorgaben einzuhalten.
Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) setzt ab 2025 verbindliche Vorgaben für die Ladeinfrastruktur in Unternehmen. Diese Regelungen unterscheiden sich je nach Art des Gebäudes und dessen Nutzung. Im Folgenden werden die wichtigsten Anforderungen sowie mögliche Ausnahmen näher beleuchtet.
Für Neubauten gilt: Ladepunkte und die entsprechende Leitungsinfrastruktur müssen von Beginn an eingeplant werden. Bei größeren Renovierungen oder bestehenden Gebäuden hängen die Vorschriften von der Anzahl der Stellplätze ab. Unternehmen mit mehreren Standorten haben die Möglichkeit, eine zentrale Quartierslösung zu nutzen, um Kosten zu senken und die Planung zu vereinfachen.
Das Gesetz verlangt außerdem, dass die technischen Mindestanforderungen erfüllt werden. Ladepunkte müssen den aktuellen Sicherheits- und Leistungsstandards entsprechen. Gleichzeitig soll die Leitungsinfrastruktur so ausgelegt sein, dass zukünftige Erweiterungen um zusätzliche Ladestationen problemlos möglich sind.
Das GEIG sieht für bestimmte Fälle Ausnahmen vor. Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Situationen mit unverhältnismäßig hohen Nachrüstungskosten können davon profitieren. Solche Ausnahmen erfordern jedoch ein Gutachten, das bauliche oder technische Besonderheiten nachweist.
Unternehmen, die die GEIG-Vorgaben nicht einhalten, müssen mit Sanktionen rechnen. Die Höhe der Strafen richtet sich nach der Schwere des Verstoßes und der Unternehmensgröße. Wiederholte Verstöße können zu deutlich strengeren Konsequenzen führen. Die Einhaltung der Vorschriften wird stichprobenartig von den Bundesländern kontrolliert. Die Frist für Nachrüstungen endet 2025 – Übergangsregelungen sind nicht vorgesehen.
Es ist daher dringend empfohlen, alle Maßnahmen und Umsetzungen im Zusammenhang mit der Ladeinfrastruktur sorgfältig zu dokumentieren, um im Fall von Kontrollen auf der sicheren Seite zu sein.
Unternehmen stehen oft vor der Entscheidung: Kaufen oder mieten? Diese Wahl zwischen einmaliger Investition (CAPEX) und monatlicher Miete (OPEX) für Ladestationen hat weitreichende Folgen – sowohl für die Einhaltung der GEIG-Vorgaben als auch für die langfristige Infrastrukturplanung. Beide Modelle wirken sich unterschiedlich auf Bilanz, Cashflow und Flexibilität aus.
Beim CAPEX-Modell kauft das Unternehmen die Ladeinfrastruktur. Die anfallenden Kosten – für Hardware, Installation und Netzanschluss – werden einmalig getragen und über 10 bis 15 Jahre abgeschrieben. Der Vorteil: volle Kontrolle und langfristig niedrigere Gesamtkosten.
Das OPEX-Modell hingegen setzt auf monatliche Mietzahlungen. Diese decken in der Regel Hardware, Installation, Wartung und Betrieb ab. Die Kosten werden direkt als Betriebsausgaben verbucht, was die Liquidität schont.
| Aspekt | CAPEX-Modell | OPEX-Modell |
|---|---|---|
| Anfangsinvestition | Hoch (15.000 € - 50.000 € pro Ladepunkt) | Niedrig (nur Anschlusskosten) |
| Monatliche Kosten | Gering (nur Strom und Wartung) | Mittel bis hoch (200 € - 800 € pro Ladepunkt) |
| Bilanzwirkung | Aktivierung und Abschreibung | Direkte Betriebskosten |
| Flexibilität | Gering (langfristige Bindung) | Hoch (meist 3-5 Jahre Laufzeit) |
| Wartung und Service | Eigenverantwortung | Im Mietpreis enthalten |
| Technologie-Updates | Eigene Investition erforderlich | Im Service inbegriffen |
Während CAPEX langfristig günstiger sein kann, birgt es Unsicherheiten bei Wartung und Updates. OPEX hingegen bietet planbare Kosten und inkludierte Services.
Große Unternehmen mit ausreichend Kapital und eigenem Facility-Management profitieren oft vom CAPEX-Modell. Sie können die hohen Anfangsinvestitionen tragen und verfügen über die nötigen Ressourcen für Betrieb und Wartung.
Für mittelständische Unternehmen ist das OPEX-Modell häufig attraktiver. Es schont die Liquidität, bindet keine zusätzlichen Personalressourcen und bietet Planungssicherheit – besonders für Unternehmen, die erstmals in Ladeinfrastruktur investieren.
Standortabhängige Überlegungen spielen ebenfalls eine Rolle: An stark frequentierten Standorten amortisiert sich CAPEX schneller. Bei geringer Nutzung oder unsicherer Auslastung bietet OPEX mehr Flexibilität. Unternehmen mit mehreren Standorten kombinieren oft beide Ansätze: CAPEX für Hauptstandorte und OPEX für kleinere Niederlassungen.
Auch die steuerliche Behandlung beeinflusst die Entscheidung. CAPEX-Investitionen lassen sich durch Sonderabschreibungen oder Investitionsabzugsbeträge optimieren. OPEX-Kosten hingegen sind sofort absetzbar, was insbesondere bei einer hohen Steuerlast vorteilhaft ist.
Der technologische Fortschritt ist ein weiterer Faktor: CAPEX birgt das Risiko, dass die Technik veraltet, während OPEX regelmäßige Updates garantiert.
Nicht zu vergessen: Förderprogramme. Diese begünstigen oft CAPEX-Modelle, da Investitionen durch Zuschüsse wirtschaftlicher werden können. Dadurch reduzieren sich die Gesamtkosten und die Amortisationszeit verkürzt sich erheblich.
Die Entscheidung für CAPEX oder OPEX ist nicht nur eine Frage der Finanzen, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Umsetzung der GEIG-Vorgaben und zur Optimierung des Mobilitätsmanagements. Im nächsten Abschnitt werfen wir einen Blick auf staatliche Zuschüsse und Anreizprogramme, die diese Entscheidungen beeinflussen können.
Nach der Finanzierung stellt sich die nächste entscheidende Frage: Wer übernimmt den Betrieb der Ladeinfrastruktur? Unternehmen können entweder einen Charge Point Operator (CPO) beauftragen oder die Ladestationen selbst betreiben. Diese Wahl hat Auswirkungen auf die Komplexität des Betriebs, die Kontrolle über Daten, die Abrechnung und die Flexibilität.
Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile der beiden Modelle übersichtlich dargestellt.
Ein CPO übernimmt den gesamten Betrieb der Ladeinfrastruktur – von der Software über die Abrechnung bis hin zur Wartung. Für Unternehmen bedeutet das eine schlüsselfertige Lösung, allerdings geht damit auch ein Teil der Kontrolle über Prozesse und Daten verloren.
Beim Eigenbetrieb hingegen behalten Unternehmen die volle Kontrolle über alle Abläufe. Dafür sind jedoch eigene Ressourcen notwendig, etwa für IT-Systeme, Kundenservice und technische Wartung.
| Aspekt | CPO-Betrieb | Eigenbetrieb |
|---|---|---|
| Personalaufwand | Gering (nur Koordination) | Hoch (IT, Service, Wartung) |
| Technische Expertise | Nicht erforderlich | Eigene Fachkräfte nötig |
| Datenkontrolle | Eingeschränkt (abhängig vom CPO) | Vollständig |
| Abrechnungsflexibilität | Vorgegebene CPO-Tarife | Individuell gestaltbar |
| Betriebskosten | Kalkulierbare monatliche Servicegebühr | Variabel, abhängig von internen Kosten |
| Skalierbarkeit | Hoch (breites Anbieter-Netzwerk) | Begrenzt (abhängig von Ressourcen) |
| GEIG-Compliance | Verantwortung liegt beim CPO | Eigene Verantwortung |
| Integration | Standard-Schnittstellen | Maßgeschneiderte Lösungen |
Der CPO-Betrieb bietet sich vor allem für Unternehmen an, die möglichst wenig Verwaltungsaufwand wünschen. Etablierte Anbieter verfügen über erprobte Prozesse und können bei Problemen schnell reagieren. Für Unternehmen ohne tiefgehende Expertise im Bereich Elektromobilität ist dies oft ein praktischer Ansatz.
Der Eigenbetrieb hingegen eröffnet mehr Gestaltungsspielraum – zum Beispiel bei individuellen Tarifen oder der Integration in bestehende IT-Systeme. Unternehmen können spezielle Mitarbeitertarife einrichten, Gästezugänge ermöglichen oder die Ladeinfrastruktur stärker an ihre Bedürfnisse anpassen.
Die Wahl des Betreibermodells hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Unternehmensgröße und den verfügbaren Ressourcen. Große Konzerne mit eigenen IT- und Facility-Management-Teams können den Eigenbetrieb leichter umsetzen. Mittelständische Unternehmen hingegen profitieren oft von einem CPO-Modell, da sie sich so stärker auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Kontrolle über Nutzerdaten. Unternehmen, die Ladeinfrastruktur als Teil ihrer Nachhaltigkeitsstrategie oder ihres Employer Brandings nutzen, benötigen oft detaillierte Nutzungsdaten – was im Eigenbetrieb einfacher umzusetzen ist.
Auch die Gegebenheiten vor Ort spielen eine Rolle. Einzelstandorte mit wenigen Ladepunkten eignen sich oft besser für den CPO-Betrieb. Unternehmen mit mehreren Standorten oder komplexen Abrechnungsanforderungen – etwa unterschiedliche Tarife für Mitarbeiter, Kunden und Besucher – profitieren hingegen häufig vom Eigenbetrieb.
Der Eigenbetrieb setzt zudem eine gewisse technische Affinität voraus. Themen wie OCPP-Protokolle, Lastmanagement oder eichrechtskonforme Abrechnung müssen berücksichtigt werden. Ohne die nötige Expertise können hier zusätzliche Kosten durch externe Beratung entstehen.
Unternehmen, die Elektromobilität strategisch vorantreiben möchten, investieren oft in eigene Kompetenzen. Für Unternehmen, die Ladeinfrastruktur primär zur Erfüllung der GEIG-Vorgaben betreiben, ist das CPO-Modell meist die einfachere Lösung.
Einige Unternehmen kombinieren beide Ansätze: öffentlich zugängliche Ladepunkte werden von einem CPO betrieben, während Mitarbeiterparkplätze im Eigenbetrieb verwaltet werden. So lassen sich die Vorteile beider Modelle optimal nutzen.
Die Wahl des Betreibermodells beeinflusst außerdem, welche Förderprogramme in Anspruch genommen werden können – ein Thema, das im nächsten Abschnitt genauer betrachtet wird.
Der Ausbau von Ladeinfrastruktur muss nicht allein aus privaten Mitteln finanziert werden. In Deutschland gibt es zahlreiche Förderprogramme, die Unternehmen dabei helfen, die Kosten für Anschaffung und Betrieb von Ladestationen zu senken. Diese Programme richten sich an Unternehmen jeder Größe und für unterschiedlichste Anwendungsbereiche.
Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) unterstützt den Ausbau von Ladestationen mit verschiedenen Förderprogrammen. Dabei werden sowohl die Hardware als auch die Installationskosten finanziell berücksichtigt. Zusätzlich bietet die KfW-Bank zinsgünstige Kredite, um Investitionen in die Elektromobilität zu erleichtern. Einige Bundesländer haben darüber hinaus eigene Förderprogramme, die regionale Unternehmen gezielt unterstützen.
Die Antragstellung erfolgt in der Regel digital und muss vor Beginn der Maßnahmen eingereicht werden. Viele Förderprogramme setzen außerdem voraus, dass ein hoher Anteil des verwendeten Stroms aus erneuerbaren Energien stammt. Diese Zuschüsse können entweder die Investitionskosten (CAPEX) senken oder die laufenden Kosten (OPEX) reduzieren. Neben allgemeinen Förderungen gibt es auch spezielle Programme, die das Laden am Arbeitsplatz fördern.
Das Laden am Arbeitsplatz wird immer wichtiger. Förderprogramme, die auf die Einrichtung von Ladestationen an Arbeitsplätzen abzielen, ermöglichen es Unternehmen, ihren Mitarbeitenden nachhaltige Mobilitätslösungen anzubieten. Neben der Installation von Ladestationen werden oft auch begleitende Maßnahmen unterstützt, wie intelligente Lastmanagementsysteme oder umfassende Mobilitätskonzepte, die Mobilitätsbudgets oder Jobtickets einbeziehen.
Darüber hinaus gibt es steuerliche Erleichterungen, die sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern Vorteile bieten. Berufsgenossenschaften und regionale Verkehrsverbünde stellen ebenfalls Fördermittel bereit, oft mit einem Fokus auf bestimmte Branchen oder Regionen, beispielsweise zur Elektrifizierung von Dienstwagenflotten.
Ein wichtiger Aspekt vieler Förderprogramme ist die langfristige Nutzung der Ladestationen. Sollte der Betrieb vorzeitig eingestellt oder die Ladestation zweckentfremdet werden, können Fördermittel zurückgefordert werden.
Die geschickte Kombination verschiedener Förderprogramme kann den Eigenanteil an den Kosten erheblich verringern. Allerdings erfordert dies eine sorgfältige Planung und Koordination der Antragsverfahren, um die maximale Unterstützung zu erhalten.
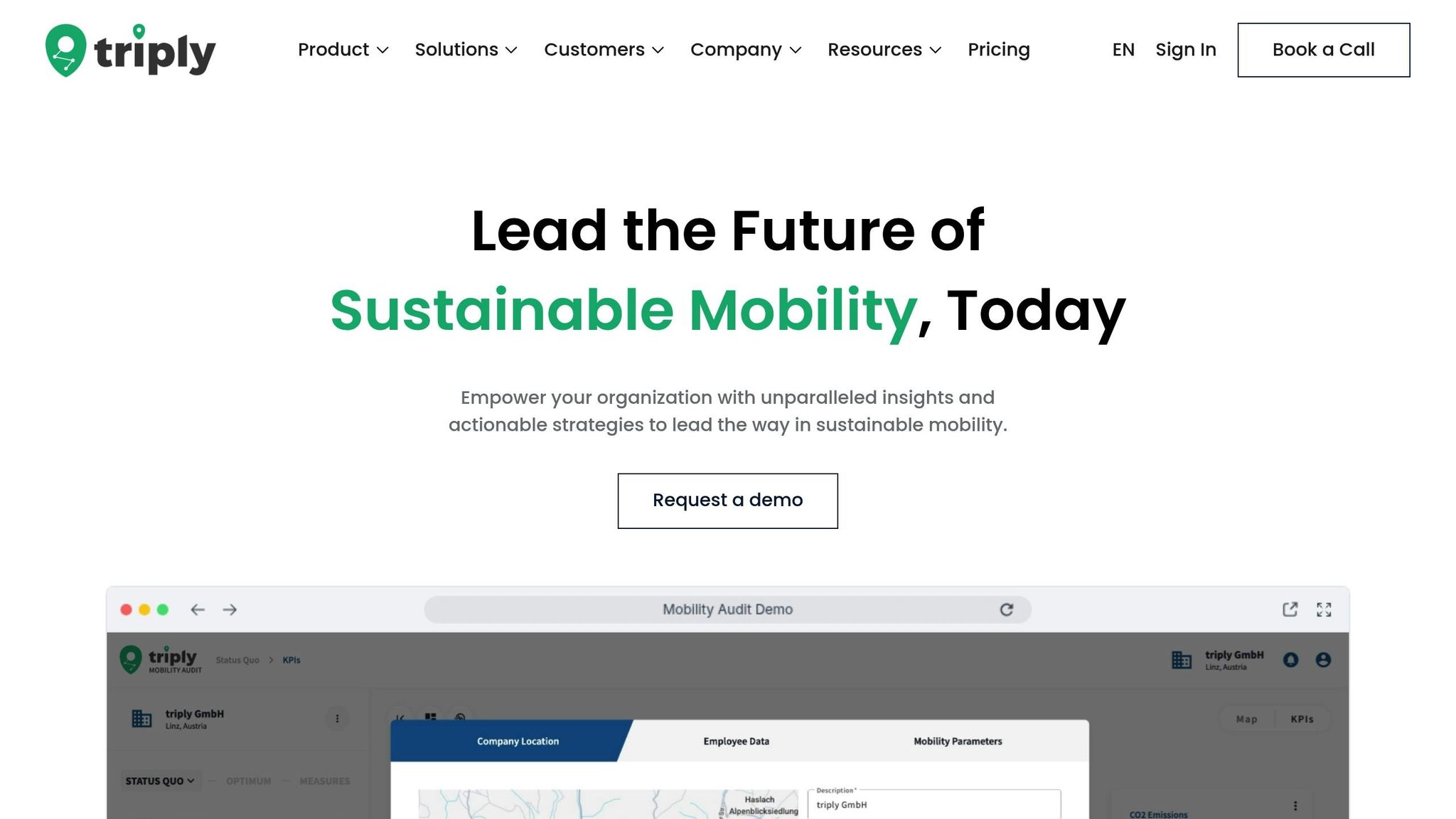
Eine effektive Planung von Ladeinfrastruktur und Mobilitätskonzepten basiert auf einer soliden Datenbasis. Hier kommt triply ins Spiel. Diese SaaS-Plattform für Mobilitätsanalysen bietet Unternehmen leistungsstarke Werkzeuge, um Mobilitätsdaten zu analysieren und Optimierungsmöglichkeiten aufzudecken. Mit Funktionen zur Visualisierung und Analyse von Verkehrs- und Pendlerströmen liefert triply die Grundlage für gezielte Verbesserungsstrategien.
triply unterstützt Unternehmen dabei, ihre Mobilitätsstrategien zu verfeinern, indem es präzise Analysen bereitstellt, die sowohl Investitions- (CAPEX) als auch Betriebskosten (OPEX) optimieren können. Die Plattform bietet detaillierte Einblicke, z. B. durch Scope-3-Emissionsberichte oder die Analyse von Pendelmustern. Unternehmen können so fundierte Entscheidungen treffen, etwa zu Ladezeiten, Ladebedarf und Spitzenlasten. Das Ergebnis? Eine Mobilitätsstrategie, die sowohl effizient als auch kosteneffektiv ist.
Darüber hinaus passt triply seine Empfehlungen individuell an die Bedürfnisse der Belegschaft und die baulichen Gegebenheiten an. Mit umfassenden Kosten-Nutzen-Analysen unterstützt die Plattform Unternehmen dabei, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Investitionen und Betriebskosten zu finden.
Ein weiterer Vorteil: Die Plattform hilft, die Mitarbeitermobilität zu optimieren. Durch die Analyse von Pendelmustern erhalten Unternehmen wertvolle Daten, um Ressourcen wie Ladeinfrastruktur besser zu nutzen und Spitzenlasten zu managen.
Neben diesen analytischen Stärken bietet triply auch flexible Preismodelle, die auf die spezifischen Anforderungen eines Unternehmens zugeschnitten sind. Die Integration der Plattform in die betriebliche Mobilitätsplanung ermöglicht nicht nur eine effizientere Ressourcennutzung, sondern auch spürbare Kosteneinsparungen.
Die Entwicklung der Elektromobilität schreitet mit beeindruckender Geschwindigkeit voran – und fordert von Unternehmen heute mehr denn je entschlossenes Handeln. Das GEIG 2025 markiert dabei den Beginn eines neuen Regulierungszyklus. Es ist zu erwarten, dass die gesetzlichen Anforderungen künftig weiter verschärft werden. Wer jetzt strategisch plant, kann sich einen klaren Vorteil sichern.
Frühzeitige Planung zahlt sich aus. Unternehmen, die frühzeitig in ihre Ladeinfrastruktur investieren, profitieren nicht nur von effizienteren Installationsprozessen, sondern auch von attraktiven Fördermöglichkeiten. Nachträgliche Anpassungen hingegen sind oft mit höheren Kosten und mehr Aufwand verbunden.
Neben den finanziellen Vorteilen ist die Einhaltung gesetzlicher Mindeststandards unverzichtbar. Die GEIG-Compliance stellt dabei die Basis dar. Doch wer über diese Mindestanforderungen hinausdenkt, beispielsweise durch gezielte Investitionen in CAPEX/OPEX-Modelle oder die Wahl eines passenden Betreibermodells, bereitet sich besser auf künftige Anforderungen und steigenden Bedarf vor. Diese Modelle, die bereits detailliert erläutert wurden, sind ein Schlüssel zu einer nachhaltigen Strategie.
Ein solides Datenfundament ist dabei entscheidend. Moderne Planungstools liefern präzise Mobilitätsdaten, die eine optimierte Infrastrukturplanung ermöglichen und strategische Entscheidungen unterstützen.
Da Förderprogramme oft nur begrenzt verfügbar sind, ist schnelles Handeln gefragt. Die Attraktivität von Förderkulissen kann sich rasch ändern. Unternehmen sollten daher aktuelle Fördermöglichkeiten prüfen und rechtzeitig Anträge stellen, um mögliche Kosteneinsparungen zu realisieren.
Auch die Bereitstellung von Lademöglichkeiten am Arbeitsplatz spielt eine zentrale Rolle – nicht nur für die Mobilitätsstrategie, sondern auch als Vorteil im Wettbewerb um Fachkräfte. Unternehmen, die frühzeitig in moderne Ladeinfrastruktur investieren, positionieren sich als innovative und nachhaltige Arbeitgeber. Diese Maßnahmen stärken das Employer Branding und fördern langfristig die Mitarbeiterbindung.
Die Kombination aus gesetzlichen Vorgaben, klugen Finanzierungsmodellen und durchdachten technischen Lösungen schafft die Grundlage für eine zukunftssichere Mobilitätsstrategie.
Unternehmen müssen ab dem 1. Januar 2025 sicherstellen, dass bei Nichtwohngebäuden mit mehr als 20 Parkplätzen mindestens ein Ladepunkt für Elektrofahrzeuge vorhanden ist. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) und erfordert eine sorgfältige und rechtzeitige Planung.
Um die Umsetzung effizient zu gestalten, ist es sinnvoll, die Ladeinfrastruktur frühzeitig zu planen und dabei gesetzliche Fristen genau im Blick zu behalten. Zusätzlich können Förderprogramme genutzt werden, um die Kosten zu reduzieren. Ein Energie- oder Umweltmanagementsystem nach ISO 50001 kann dabei unterstützen, die Anforderungen strukturiert und effektiv zu erfüllen und mögliche Bußgelder zu vermeiden. Mit diesen Schritten sichern Sie die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und positionieren Ihr Unternehmen zukunftsorientiert.
Unternehmen stehen bei der Entscheidung zwischen CAPEX- und OPEX-Modellen vor wichtigen Überlegungen. Dazu zählen langfristige Kosten, verfügbare finanzielle Mittel und strategische Prioritäten.
CAPEX-Modelle erfordern zwar eine höhere Anfangsinvestition, bieten aber den Vorteil des Eigentums und potenzieller Wertsteigerungen der Ladeinfrastruktur. OPEX-Modelle hingegen senken die Einstiegskosten und ermöglichen planbare, regelmäßige Ausgaben, was die Liquidität des Unternehmens schont.
In Deutschland können Förderprogramme, die bis 2025 laufen, die Investitionskosten erheblich reduzieren und so die Wahl des Modells beeinflussen. Um die beste Lösung zu finden, ist eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse unerlässlich, die sowohl die individuellen Anforderungen als auch die finanzielle Situation des Unternehmens berücksichtigt.
Unternehmen in Deutschland haben 2025 die Möglichkeit, von verschiedenen Förderprogrammen zu profitieren, die den Aufbau von Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz unterstützen. Ein Beispiel ist das KfW-Programm 441, das pro Ladepunkt Zuschüsse von bis zu 900 € bereitstellt.
Zusätzlich bietet das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) Förderungen von bis zu 45.000 € pro Standort an, um den Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur zu unterstützen.
Ergänzend dazu existieren zahlreiche regionale und kommunale Förderprogramme, die Unternehmen den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern und gleichzeitig eine nachhaltigere Mobilität in Deutschland voranbringen.
Unternehmen müssen ab dem 1. Januar 2025 sicherstellen, dass bei Nichtwohngebäuden mit mehr als 20 Parkplätzen mindestens ein Ladepunkt für Elektrofahrzeuge vorhanden ist. Diese Verpflichtung ergibt sich aus dem Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) und erfordert eine sorgfältige und rechtzeitige Planung.
Unternehmen stehen bei der Entscheidung zwischen CAPEX- und OPEX-Modellen vor wichtigen Überlegungen, einschließlich langfristiger Kosten und strategischer Prioritäten. CAPEX erfordert eine höhere Anfangsinvestition, während OPEX planbare, regelmäßige Ausgaben benötigt.
Unternehmen in Deutschland können von verschiedenen Förderprogrammen profitieren, die den Aufbau von Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz unterstützen, beispielsweise das KfW-Programm 441 und Förderungen des BMDV.
KMU können unter bestimmten Umständen von Ausnahmen bei den GEIG-Vorgaben profitieren, insbesondere wenn hohe Nachrüstungskosten anfallen. Ein Gutachten ist hierfür erforderlich.
CAPEX-Modelle bieten langfristige Kostenvorteile und Eigentum an der Ladeinfrastruktur, während OPEX-Modelle weniger Anfangsinvestitionen erfordern und planbare monatliche Kosten bieten.