Erfahren Sie, wie Unternehmen Pendlerdaten DSGVO-konform erheben und gleichzeitig das Vertrauen der Mitarbeitenden stärken können.

Mitarbeiterdaten schützen und Vertrauen stärken – so gelingt DSGVO-Konformität bei Pendlerdaten. Unternehmen benötigen Pendlerdaten, um Mobilitätsprogramme wie Fahrgemeinschaften oder Jobtickets zu optimieren. Doch diese Daten sind sensibel und unterliegen strengen DSGVO-Vorgaben. Mit klaren Regeln zu Transparenz, Zweckbindung und Datenminimierung sowie der Einholung von Einwilligungen können Firmen Bußgelder vermeiden und das Vertrauen der Belegschaft gewinnen.
Plattformen wie triply erleichtern die DSGVO-konforme Analyse von Pendlerdaten durch Anonymisierung und einfache Einwilligungsverwaltung. So können Firmen Mobilitätsprogramme umsetzen, ohne Datenschutz zu gefährden.
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gibt klare Richtlinien vor, wie personenbezogene Daten verarbeitet werden dürfen. Zu den zentralen Prinzipien gehören Rechtmäßigkeit, Fairness und Transparenz. Mitarbeitende müssen stets darüber informiert werden, welche Daten gesammelt werden und warum[6].
Ein wichtiger Aspekt ist die Zweckbindung: Pendlerdaten dürfen ausschließlich für den festgelegten Zweck genutzt werden. Werden sie beispielsweise zur Verbesserung des Jobticket-Angebots erhoben, ist eine Nutzung für andere Zwecke, wie etwa Leistungsbewertungen, unzulässig[6].
Auch die Datenminimierung spielt eine entscheidende Rolle. Es sollten nur die notwendigsten Informationen erfasst werden – etwa die Wahl des Verkehrsmittels statt genauer GPS-Koordinaten[1].
Die Speicherbegrenzung verpflichtet Unternehmen, klare Löschfristen festzulegen. Pendlerdaten dürfen nur so lange aufbewahrt werden, wie sie für den ursprünglichen Zweck benötigt werden. Nach deutschem Recht ist es Arbeitgebern in bestimmten Fällen erlaubt, personenbezogene Daten auch ohne ausdrückliche Einwilligung zu verarbeiten, wenn dies für das Arbeitsverhältnis erforderlich ist – etwa für dessen Beginn, Durchführung oder Beendigung[1].
Im nächsten Abschnitt geht es um die Rechte der Mitarbeitenden im Zusammenhang mit ihren Daten.
Die DSGVO sichert Mitarbeitenden spezifische Rechte, die durch technische und organisatorische Maßnahmen geschützt werden müssen.
Neben diesen Rechten der Mitarbeitenden müssen Unternehmen bestimmte Pflichten erfüllen, um DSGVO-konform zu handeln.
Unternehmen, die Pendlerdaten verarbeiten, tragen eine große Verantwortung. Sie müssen die Einhaltung der Datenschutzgrundsätze umfassend dokumentieren. Dazu gehört, genau festzuhalten, welche Daten verarbeitet werden, zu welchem Zweck, wo sie gespeichert sind, wie lange sie aufbewahrt werden und welche Sicherheitsmaßnahmen gelten[6].
Bei Verarbeitungen mit hohem Risiko – etwa bei der Erhebung von Gesundheitsdaten oder genauen Standortinformationen – ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA) erforderlich[3].
In manchen Fällen ist zudem die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten vorgeschrieben. Außerdem haben Betriebsräte in Deutschland Mitbestimmungsrechte, insbesondere bei der Einführung von Technologien zur Datensicherheit oder der Verarbeitung von Mitarbeiterdaten[1].
Wenn externe Dienstleister Zugang zu Pendlerdaten erhalten, müssen Unternehmen Auftragsverarbeitungsverträge abschließen, die sicherstellen, dass auch diese Dienstleister DSGVO-konform handeln[6].
Der erste Schritt zur rechtskonformen Erhebung von Pendlerdaten ist die Einholung einer gültigen Einwilligung. Diese muss freiwillig, informiert, spezifisch und eindeutig sein[8]. Das bedeutet, dass Mitarbeitende ohne Druck entscheiden können und ihre Zustimmung klar durch eine Erklärung oder aktive Handlung geben. Eine stillschweigende Zustimmung oder Opt-in-Erklärungen reichen hierfür nicht aus[8].
Bei der Erstellung der Datenschutzerklärung sollten Sie klar darlegen, wer für die Daten verantwortlich ist, welche Daten erhoben werden, warum sie verarbeitet werden und wofür sie genutzt werden[8]. Zudem ist es wichtig, Mitarbeitende darüber zu informieren, dass sie ihre Einwilligung jederzeit auf einfache Weise widerrufen können – genauso unkompliziert, wie sie diese ursprünglich erteilt haben[8].
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Abwägung zwischen den berechtigten Interessen des Arbeitgebers und den Rechten der Mitarbeitenden. Die Interessen des Arbeitgebers dürfen die Rechte der Mitarbeitenden nicht überwiegen[2]. Diese Abwägung sollte sorgfältig dokumentiert werden[9]. Mit klaren Einwilligungen schaffen Sie eine Grundlage für eine vertrauensvolle und rechtskonforme Datenerhebung. Im nächsten Schritt sorgen Privacy-by-Design-Maßnahmen für die Sicherheit und Integrität der Daten.
Privacy by Design bedeutet, Datenschutz von Anfang an in die Entwicklung von IT-Systemen und Prozessen einzubeziehen[10]. Hierzu gehören datenschutzfreundliche Voreinstellungen wie Datenminimierung und Speicherbegrenzung[10].
Ein bewährtes Verfahren ist die Pseudonymisierung, bei der personenbezogene Daten so verarbeitet werden, dass sie ohne zusätzliche Informationen nicht mehr einer bestimmten Person zugeordnet werden können[10]. Statt vollständiger Namen könnten beispielsweise anonyme Kennungen verwendet werden.
Bei Pendlerdaten bedeutet Datenminimierung, dass nur die Informationen erhoben werden, die unbedingt notwendig sind. Für die Optimierung eines Jobticket-Angebots könnten beispielsweise nur Daten zum genutzten Verkehrsmittel erforderlich sein, nicht jedoch die genaue Route oder detaillierte Zeitangaben[10].
Ein weiteres Prinzip ist Transparenz: Mitarbeitende sollten jederzeit einsehen können, welche Daten gespeichert sind, und die Möglichkeit haben, diese zu korrigieren oder löschen zu lassen[10]. Sicherheitsmaßnahmen wie Verschlüsselung, sichere Übertragungswege und regelmäßige System-Updates sollten ebenfalls von Beginn an berücksichtigt werden[10]. Nach der Einführung solcher Maßnahmen muss die Datensicherheit kontinuierlich überwacht werden.
Um Pendlerdaten sicher zu speichern und zu verwalten, sind umfassende technische und organisatorische Maßnahmen erforderlich. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DPIA) hilft dabei, Risiken bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu erkennen und zu verringern[11].
Zugangskontrollen spielen hierbei eine zentrale Rolle: Nur autorisierte Personen sollten Zugriff auf die Daten haben. Granulare Berechtigungen legen genau fest, wer Dateien einsehen, bearbeiten oder herunterladen darf[11]. Diese Berechtigungen sollten regelmäßig überprüft und bei Personalwechseln sofort angepasst werden[12].
Eine klare Aufbewahrungsrichtlinie bestimmt, wie lange Daten gespeichert werden und was mit ihnen geschieht, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Automatische Löschfunktionen, sobald der ursprüngliche Zweck entfällt, sind hierbei essenziell[11].
Technische Maßnahmen wie Verschlüsselung und Pseudonymisierung werden von der DSGVO ausdrücklich empfohlen und sollten sowohl bei der Speicherung als auch bei der Übertragung von Daten eingesetzt werden[11]. Audit-Protokolle, die alle Dateiaktivitäten dokumentieren, helfen, die Einhaltung der Datenschutzvorgaben zu überprüfen und mögliche Verstöße aufzuklären[12].
Regelmäßige Schulungen für Mitarbeitende sind ebenfalls wichtig. Nur wenn alle Beteiligten die Bedeutung des Datenschutzes verstehen, können sie DSGVO-konform handeln[11].
Falls Daten außerhalb der EU übertragen werden, sind zusätzliche Garantien erforderlich, wie Standardvertragsklauseln, Angemessenheitsbeschlüsse oder verbindliche Unternehmensregeln[13]. Diese Maßnahmen stärken nicht nur die DSGVO-Konformität, sondern auch das Vertrauen der Mitarbeitenden in den verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten.
Transparente Kommunikation ist der Schlüssel, um das Vertrauen der Mitarbeitenden bei der Erhebung von Pendlerdaten zu gewinnen. Laut einer Umfrage bestätigen 86 % der Führungskräfte, dass mehr Transparenz das Vertrauen stärkt, und 74 % bezeichnen Vertrauen und Offenheit als besonders wichtig[14].
Bereits beim Onboarding sollte die Kommunikation über Datennutzung beginnen. Aktualisieren Sie Datenschutzerklärungen und formulieren Sie diese in einfacher, verständlicher Sprache[4]. Vermitteln Sie den Mitarbeitenden klar, auf welcher Rechtsgrundlage die Daten erhoben werden, wie lange sie gespeichert bleiben und welche Rechte sie – wie das Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörden – haben[4].
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, den persönlichen Nutzen der Datenerhebung hervorzuheben. Eine Studie von Gartner zeigt, dass 96 % der digitalen Arbeitskräfte eine intensivere Datenüberwachung akzeptieren würden, wenn sie dafür Vorteile wie gezielte Schulungen oder bessere Karrierechancen erhalten[14]. Erklären Sie, wie die Datenerhebung solche Vorteile ermöglichen kann.
Wie bereits erwähnt, müssen Opt-in-Verfahren klar, informiert und eindeutig sein[4]. Geben Sie den Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Angaben zu aktualisieren und selbst zu entscheiden, welche Daten erhoben werden[4].
Nach der Informationsvermittlung sollte der Austausch nicht enden – Feedback der Mitarbeitenden ist ein essenzieller nächster Schritt.
Nach einer offenen Kommunikation ist es entscheidend, die Mitarbeitenden aktiv einzubinden. Organisieren Sie Gespräche zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften, um gemeinsam zu klären, welche Daten erhoben werden, warum dies geschieht und wie der Prozess gestaltet wird[14]. Solche Gespräche fördern nicht nur das Vertrauen, sondern geben auch Einblicke in die Bedürfnisse der Belegschaft[14].
Mitarbeitende, die selbst entscheiden können, wann und wofür ihre Daten erhoben werden, zeigen oft mehr Vertrauen in ihre Organisation[14].
Anonyme Feedback-Systeme bieten eine weitere Möglichkeit, Bedenken offen und ohne Hemmungen zu äußern[16]. Diese Systeme sollten regelmäßig genutzt werden, um die Akzeptanz der Datenerhebung zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen.
"Trust happens when leaders are transparent" – Jack Welch[15]
Zusätzlich sollten Mitarbeitende die Möglichkeit haben, fehlerhafte Daten anzufechten oder Bedenken über deren Nutzung zu äußern[14]. Offene Diskussionen über Überwachungspraktiken können das Gefühl einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit verstärken[16].
Die frühzeitige Einbindung von Datenschutzbeauftragten ist entscheidend, um DSGVO-konforme und transparente Prozesse zu gewährleisten. Diese Experten helfen, datenschutzkonforme Verfahren zu entwickeln und die Rechte der Mitarbeitenden zu schützen. Sie sollten von Beginn an in die Planung der Datenerhebung eingebunden werden und regelmäßige Schulungen für alle Beteiligten anbieten[4]. Verträge mit externen Anbietern müssen klar regeln, wie Mitarbeitendendaten verarbeitet werden[4].
Betriebsräte spielen eine wichtige Rolle, da sie die Perspektive der Mitarbeitenden einbringen. Sie können frühzeitig Bedenken erkennen und ansprechen, was den Mitarbeitenden zeigt, dass ihre Interessen berücksichtigt werden. Ihre Beteiligung verleiht dem Projekt zusätzliche Glaubwürdigkeit.
Nur 37 % der Mitarbeitenden geben an, großes Vertrauen in den verantwortungsvollen Umgang ihres Unternehmens mit Arbeits- und Belegschaftsdaten zu haben[14]. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Mitarbeitende ihrer Organisation vertrauen, um 35 %, wenn sie überzeugt sind, dass ihre Daten verantwortungsvoll genutzt werden[14]. Regelmäßige Gespräche mit Datenschutzbeauftragten und Betriebsräten tragen entscheidend dazu bei, dieses Vertrauen zu stärken.
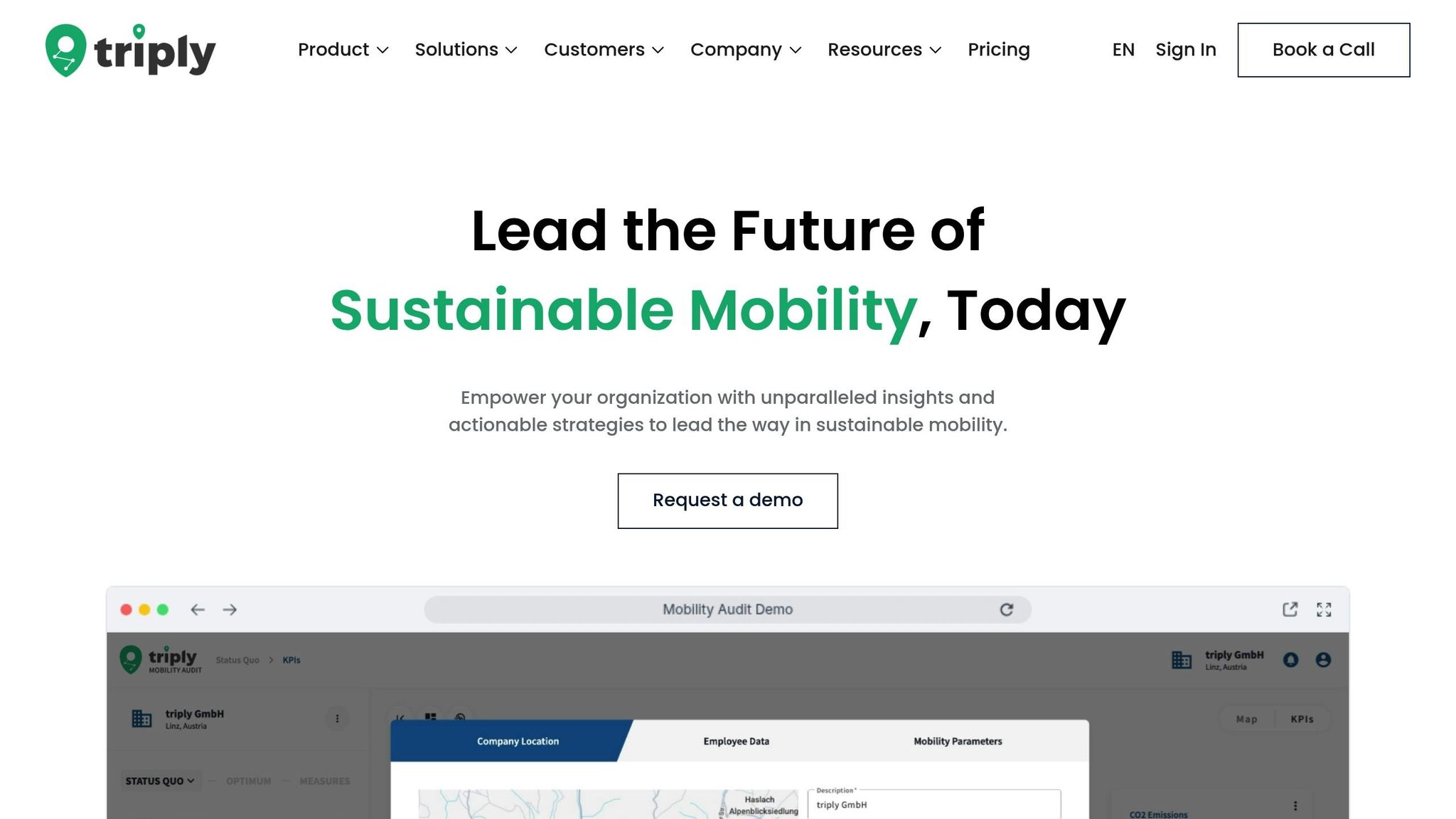
triply ist eine Plattform, die Mobilitätsanalysen unter Berücksichtigung der DSGVO ermöglicht. Der Datenschutz ist hier von Anfang an in die Architektur integriert und orientiert sich an den Privacy-by-Design-Prinzipien.
Die Plattform bietet eine transparente Verwaltung von Einverständniserklärungen. Mitarbeitende können jederzeit nachvollziehen, welche Daten erfasst werden, und ihre Zustimmung gezielt steuern. Alle Einwilligungen sowie Datenverarbeitungsprotokolle werden automatisch dokumentiert.
Die Analysewerkzeuge von triply arbeiten mit aggregierten Pendlerdaten, um Scope-3-Emissionsberichte zu erstellen – ohne dabei einzelne Personen identifizierbar zu machen. Durch diese Anonymisierung bleibt die Privatsphäre der Mitarbeitenden geschützt, während gleichzeitig aussagekräftige Umweltberichte erstellt werden können.
Mitarbeitende haben zudem die Möglichkeit, ihre Daten einzusehen, zu korrigieren oder löschen zu lassen. Auch die Datenportabilität wird unterstützt, sodass Daten in einem strukturierten und gängigen Format bereitgestellt werden können[18].
triply gewährleistet nicht nur die Rechte der Betroffenen, sondern bietet auch auditfähige Dokumentationen für Compliance-Zwecke. Alle Datenverarbeitungsaktivitäten, Einwilligungsnachweise und Zugriffsprotokolle werden detailliert festgehalten und können bei Prüfungen exportiert werden[17]. Diese Funktionen schaffen eine solide Grundlage für weitergehende Datenschutzmaßnahmen.
Ein Beispiel für den Erfolg dieser Ansätze zeigt sich bei den Stadtwerken München (SWM): Durch anonyme Analysen mit triply konnten sie Autofahrten um 12 % reduzieren und so jährlich etwa 1.800 Tonnen CO₂ einsparen. Das gesamte Projekt wurde in enger Abstimmung mit dem Betriebsrat und dem Datenschutzbeauftragten durchgeführt, um die DSGVO-Konformität sicherzustellen[19].
Zusätzlich bietet triply flexible Tarifmodelle, die sich an die spezifischen Anforderungen und die Größe eines Unternehmens anpassen lassen.
triply stellt drei Haupttarife zur Verfügung, die auf verschiedene Organisationsgrößen und Anforderungen zugeschnitten sind. Alle Tarife umfassen grundlegende DSGVO-Compliance-Funktionen, unterscheiden sich jedoch in der Tiefe der Analysen und dem Umfang der Unterstützung.
| Tarif | Analysen & Visualisierung | Scope-3-Berichterstattung | Datenanonymisierung | Einverständnismanagement | Integration (HR/ERP) | Support | Preis (€/Monat) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | ~500 | |
| Professional | Ja | Ja | Ja | Ja | Begrenzt | Telefon/E-Mail | ~1.200 |
| Enterprise | Ja | Ja | Ja | Ja | Vollständig | Dediziert | Individuell |
Bis 2024 haben bereits über 100 Organisationen in Deutschland und Österreich triply für DSGVO-konforme Mobilitätsanalysen genutzt[19]. Die Plattform hat Unternehmen dabei unterstützt, ihre Scope-3-Emissionen um bis zu 15 % zu senken – durch datenbasierte und anonymisierte Mobilitätsstrategien[19].
Die Erfassung von Pendlerdaten im Einklang mit der DSGVO erfordert mehr als nur die Einhaltung rechtlicher Vorgaben – sie setzt eine Vertrauenskultur zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitenden voraus. Laut einer Umfrage wünschen sich 82 % der Deutschen, dass ihre persönlichen Daten privat bleiben, und 78,4 % ergreifen aktiv Maßnahmen, um ihre Daten zu schützen [7]. Solche Zahlen verdeutlichen, wie wichtig Datenschutz im Arbeitsumfeld ist.
Ein abschreckendes Beispiel liefert der Fall H&M aus dem Jahr 2020. Über Jahre hinweg sammelten Manager des Nürnberger Servicecenters heimlich private Informationen über Mitarbeitende. Das Ergebnis: eine Millionenstrafe und ein massiver Vertrauensverlust [7].
Um solche Szenarien zu vermeiden, ist Privacy by Design der Schlüssel. Unternehmen sollten von Anfang an auf Datenschutz setzen: Opt-in-Zustimmungen einholen, Mitarbeitende regelmäßig schulen und leicht verständliche Datenschutzhinweise bereitstellen [7]. Transparenz ist dabei essenziell – Mitarbeitende müssen genau wissen, welche Daten erhoben werden, warum dies geschieht und wie lange diese gespeichert bleiben.
Technologische Lösungen zeigen, dass Datenschutz und Mobilitätsanalysen sich nicht ausschließen müssen. Plattformen wie triply bieten Werkzeuge, die sowohl datenschutzkonform als auch funktional sind. Die enge Zusammenarbeit mit Betriebsräten und Datenschutzbeauftragten hilft dabei, rechtliche Anforderungen zuverlässig zu erfüllen.
Am Ende steht eines fest: Transparente Kommunikation ist der Dreh- und Angelpunkt. Unternehmen, die auf Offenheit, Mitbestimmung und technische Datenschutzmaßnahmen setzen, schaffen nicht nur die Grundlage für DSGVO-Konformität, sondern auch für das Vertrauen, das langfristige Mobilitätsstrategien erst möglich macht.
Um die Zustimmung der Mitarbeitenden datenschutzgerecht einzuholen, sollten Unternehmen klare und leicht verständliche Einwilligungserklärungen bereitstellen. Diese sollten den Zweck der Datenerhebung deutlich und transparent erklären. Dabei ist entscheidend, dass die Einwilligung freiwillig erfolgt – ohne jeglichen Druck oder drohende Nachteile für die Mitarbeitenden.
Es ist ebenso wichtig, dass Mitarbeitende vorab umfassend über ihre Rechte informiert werden. Dazu gehört insbesondere das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Einwilligung sollte entweder schriftlich oder elektronisch dokumentiert werden, um bei Bedarf den Nachweis erbringen zu können. Zusätzlich ist es sinnvoll, regelmäßig zu überprüfen, ob die erteilte Einwilligung weiterhin gültig und aktuell ist.
Mit diesen Maßnahmen können Unternehmen sicherstellen, dass sie nicht nur die Anforderungen der DSGVO erfüllen, sondern auch das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden stärken.
Um Privacy by Design bei der Nutzung von Pendlerdaten umzusetzen, sollten Datenschutzmaßnahmen von Anfang an in die Entwicklung des IT-Systems einfließen. Das bedeutet: Nur die wirklich notwendigen Daten sollten erhoben werden. Sensible Informationen? Diese gehören konsequent verschlüsselt. Und der Zugriff? Der sollte strikt geregelt sein – nur autorisierte Personen dürfen darauf zugreifen.
Auch regelmäßige Sicherheitschecks und eine lückenlose Dokumentation aller Datenschutzmaßnahmen sind unverzichtbar. Diese Schritte helfen nicht nur dabei, die Vorgaben der DSGVO zu erfüllen, sondern stärken auch das Vertrauen der Mitarbeitenden in den Umgang mit ihren Daten.
Betriebsräte tragen eine entscheidende Verantwortung, wenn es darum geht, den Schutz personenbezogener Daten im Unternehmen sicherzustellen. Laut § 79a BetrVG sind sie verpflichtet, darauf zu achten, dass sämtliche Datenschutzvorgaben eingehalten werden. Besonders wichtig ist es, Betriebsräte frühzeitig in alle Prozesse einzubinden, die datenschutzrelevant sind – vor allem, wenn es um die Verarbeitung von Mitarbeiterdaten geht.
Datenschutzbeauftragte spielen eine unterstützende Rolle, um die Einhaltung der DSGVO im Unternehmen sicherzustellen. Sie stehen sowohl den Betriebsräten als auch der Unternehmensleitung beratend zur Seite. Ihr Ziel ist es, gesetzliche Anforderungen umzusetzen und gleichzeitig das Vertrauen der Mitarbeitenden zu stärken. Eine enge und koordinierte Zusammenarbeit zwischen Betriebsräten und Datenschutzbeauftragten ist dabei unverzichtbar, um Datenschutzstandards und Transparenz innerhalb des Unternehmens zu sichern.
Unternehmen sollten klare Einwilligungserklärungen bereitstellen, die den Zweck der Datenerhebung transparent erklären. Die Einwilligung muss freiwillig erfolgen und Mitarbeitende über ihre Rechte informiert werden. Diese sollte dokumentiert werden.
Privacy by Design sollte in die Entwicklung von IT-Systemen integriert werden, indem nur notwendige Daten erhoben werden, sensible Daten verschlüsselt werden und der Zugriff streng geregelt ist. Regelmäßige Sicherheitschecks sind ebenfalls erforderlich.
Betriebsräte sind verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung von Datenschutzvorgaben und sollten frühzeitig in datenschutzrelevante Prozesse eingebunden werden. Datenschutzbeauftragte unterstützen hierbei und beraten das Unternehmen.
Transparenz stärkt das Vertrauen der Mitarbeitenden und sorgt dafür, dass sie die Datenerhebung besser verstehen. Dadurch wird die Akzeptanz erhöht, was für die Effektivität von Mobilitätsprogrammen entscheidend ist.
Unternehmen sollten technische Maßnahmen wie Verschlüsselung, Pseudonymisierung und regelmäßige Sicherheitsüberprüfungen implementieren, um einen rechtskonformen und sicheren Umgang mit Pendlerdaten zu gewährleisten.