Automatisierte Pendlerdatenerfassung ist entscheidend für Unternehmen zur Reduzierung von Emissionen und zur Erfüllung von CSRD-Vorgaben.

Scope 3.7-Emissionen entstehen durch das Pendeln von Mitarbeitenden und machen oft bis zu 75 % der Scope 3-Emissionen eines Unternehmens aus. Mit neuen Berichtspflichten wie der CSRD wird eine präzise Datenerfassung immer wichtiger. Automatisierte Systeme bieten hier eine Lösung: Sie ermöglichen die Erhebung von Pendlerdaten in Echtzeit, reduzieren Fehler und schaffen eine solide Grundlage für Maßnahmen wie die Förderung nachhaltiger Verkehrsmittel oder Homeoffice-Optionen.
Wichtige Punkte:
Plattformen wie triply helfen Unternehmen, diese Anforderungen effizient zu erfüllen und gleichzeitig Kosten zu senken sowie die Mitarbeitermobilität zu optimieren.
Die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) bildet die Grundlage für die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland und der EU [2]. Diese Richtlinie ersetzt die frühere Non-Financial Reporting Directive (NFRD) und erweitert die Berichtspflichten erheblich. Besonders bemerkenswert: Die Anzahl der berichtspflichtigen Unternehmen steigt von 11.000 auf fast 50.000 [2]. Nachfolgend werden die zentralen Anforderungen und notwendigen Datenpunkte für Scope 3.7-Emissionen beschrieben.
In Deutschland erfolgt die Umsetzung der CSRD durch das CSRD-Umsetzungsgesetz, das Änderungen im Handelsgesetzbuch (HGB) vorsieht. Ab 2025 sind Unternehmen verpflichtet, einen Emissionsreduktionsplan vorzulegen [2] [3].
Ein Kernpunkt der CSRD ist das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit: Unternehmen müssen sowohl die Risiken des Klimawandels für ihr Geschäft als auch ihre eigenen Auswirkungen auf das Klima offenlegen [2]. Dazu gehört auch die Berichterstattung über Scope 3-Emissionen, einschließlich der Emissionen durch das Pendeln der Mitarbeiter. Die Nachhaltigkeitsdaten müssen in einem standardisierten digitalen Format eingereicht und zusammen mit den Finanzinformationen im Lagebericht veröffentlicht werden [2].
| Unternehmenstyp | Kriterien | Berichtsfrist |
|---|---|---|
| Große Unternehmen | Börsennotierte und nicht börsennotierte EU-Unternehmen mit: • Mehr als 250 Mitarbeitern • Nettoumsatz über 40 Mio. € • Bilanzsumme über 20 Mio. € |
Bericht für GJ 2025 fällig in GJ 2026 |
| Kleine und mittlere börsennotierte Unternehmen | Börsennotierte EU-Unternehmen, die nicht als „groß“ gelten, ausgenommen Kleinstunternehmen | Bericht für GJ 2026 fällig in GJ 2027 |
| Außereuropäische Unternehmen | Nicht-EU-Unternehmen mit 150 Mio. € Nettoumsatz in der EU und mindestens einer großen EU-Tochtergesellschaft oder EU-Niederlassung mit über 40 Mio. € Nettoumsatz | Bericht für GJ 2028 fällig in GJ 2029 |
Um Scope 3.7-Emissionen korrekt zu erfassen, sind spezifische Datenpunkte erforderlich, die sich aus den gesetzlichen Vorgaben ableiten [1]. Dazu gehören:
Unternehmen sollten systematisch Informationen zu privaten Fahrzeugen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrgemeinschaften und Firmen-Shuttles sammeln. Auch alternative Verkehrsmittel wie Fahrräder oder Fußwege müssen berücksichtigt werden [1].
Eine zentrale Datenquelle sind Mitarbeiterbefragungen [1]. Zusätzlich kann die Analyse der Parkplatznutzung Hinweise auf die Anzahl der mit dem Auto pendelnden Mitarbeiter liefern. Wo möglich, sollten auch Daten lokaler Verkehrsbetriebe einbezogen werden [1]. Beispiele aus der Praxis zeigen unterschiedliche Ansätze:
Neben der Datenerhebung für Scope 3.7 müssen Unternehmen strenge Datenschutzanforderungen einhalten. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regeln den Umgang mit personenbezogenen Daten [5]. Das BDSG enthält spezielle Bestimmungen für die Verarbeitung von Mitarbeiterdaten [7].
Verstöße gegen diese Vorschriften können teuer werden: Es drohen Bußgelder von bis zu 20 Mio. € oder 4 % des weltweiten Jahresumsatzes. Datenschutzverstöße müssen zudem innerhalb von 72 Stunden gemeldet werden [5]. Unternehmen sind verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, wenn mindestens 20 Personen automatisiert personenbezogene Daten verarbeiten [5].
Ein Blick in die Praxis zeigt die möglichen Konsequenzen:
Die DSGVO und das BDSG verlangen transparente Datenverarbeitung, die Einwilligung der Mitarbeiter sowie technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten [6]. Diese Anforderungen machen eine automatisierte Erfassung der Pendlerdaten unverzichtbar Ein Thema, das im nächsten Abschnitt näher beleuchtet wird.
Nachdem die rechtlichen Grundlagen geklärt sind, wird deutlich, wie Automatisierungslösungen die Erfassung von Pendlerdaten effizienter gestalten können. Automatisierte Systeme helfen nicht nur, CO₂-Emissionen zu senken und Kosten zu reduzieren, sondern stärken auch das Employer Branding [9]. Der erste Schritt ist eine Bedarfsanalyse, um die von den Mitarbeitenden genutzten Verkehrsmittel zu ermitteln [9].
Definieren Sie klare Ziele, wie etwa die Reduktion von CO₂-Emissionen, eine optimierte Parkplatznutzung oder die Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden [9]. Erstellen Sie darauf basierend einen Plan und führen Sie ein Pilotprojekt durch, bevor Sie die Lösung vollständig umsetzen. Der Erfolg kann anhand von Kennzahlen wie dem Modal Split oder den eingesparten Kosten gemessen werden. Diese Systeme lassen sich zudem problemlos in die gesetzlichen Berichtspflichten integrieren.
Mitarbeiterumfragen sind ein zentraler Baustein, um das Engagement der Belegschaft zu messen und ihnen eine Stimme zu geben [14]. Sorgen Sie für Anonymität, um ehrliche Antworten zu fördern, und bieten Sie verschiedene Methoden wie Online-Umfragen, Papierformate oder hybride Ansätze an, um möglichst viele Mitarbeitende zu erreichen. Personalisierte Umfragen, die auf Mitarbeiter-Metadaten basieren, sowie die Einbindung der Mitarbeitenden in die Gestaltung der Fragen können die Teilnahmebereitschaft deutlich erhöhen. Mehrsprachige Optionen und barrierefreie Gestaltung gemäß WCAG 2.1 Level AA tragen ebenfalls dazu bei, die Rücklaufquote zu steigern [12].
Ein weiterer Pluspunkt ist die Anpassung der Umfragen an das Unternehmensbranding, was den Wiedererkennungswert erhöht und die Teilnahme verbessert. Ermöglichen Sie eine anonymisierte Teilnahme durch randomisierte Transaktionsnummern und Links und kommunizieren Sie klar, wer Zugang zu den Ergebnissen und Berichten hat [13].
Neben Umfragen können auch technische Lösungen wie GPS-Tracking zusätzliche Daten liefern.
Mit GPS-Tracking und elektronischen Fahrtenbüchern lassen sich Pendlermuster in Echtzeit überwachen. Diese Daten können in Mobilitätsanalyseplattformen integriert werden, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Datenschutz spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Unternehmen sollten Verschlüsselungstechnologien und sichere Übertragungsprotokolle einsetzen, um die Netzwerksicherheit zu gewährleisten und personenbezogene Daten zu schützen [16].
Flexiblere Arbeitsmodelle, wie etwa Homeoffice, tragen ebenfalls zur Reduktion von Pendleremissionen bei, da sie die tägliche Anreise verringern [11].
Sobald interne Daten gesammelt wurden, können diese durch externe Mobilitätsdaten ergänzt werden, um eine noch umfassendere Analyse zu ermöglichen.
Die Kombination interner Daten mit öffentlich zugänglichen Informationen schafft ein vollständigeres Bild der Mobilität. Neue gesetzliche Vorgaben erleichtern die Integration öffentlicher Verkehrsdaten. Im Oktober 2024 verabschiedete die deutsche Bundesregierung einen Vorschlag des Bundesverkehrsministeriums, der Unternehmen dazu verpflichtet, Reise- und Verkehrsdaten in einem standardisierten Format bereitzustellen [16].
Der Mobility Data Space (MDS) bietet eine Plattform für den Austausch von Mobilitätsdaten zwischen Unternehmen und Kommunen [10]. Dieses vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) unterstützte Projekt ist Teil der europäischen Gaia-X-Cloud-Initiative und fördert den sicheren und effizienten Austausch von Mobilitätsdaten mit wirtschaftlichem und verkehrspolitischen Nutzen [10].
Der European Mobility Data Space ermöglicht darüber hinaus den interoperablen Datenaustausch [15] [16].
„Die Nutzung von Mobilitätsdaten aus verschiedenen Quellen schafft Mobilitätsangebote, die spontane Änderungen über Reisevereinbarungen hinweg ermöglichen." – Stefan Klinge, Executive Business Consultant, msg for automotive gmbh [16]
Ein rechtlicher Rahmen ist unerlässlich, um den sicheren und effektiven Umgang mit Mobilitätsdaten im Smart-City-Ökosystem zu gewährleisten. Dabei sollten nationale und internationale Standards wie die DSGVO und der Data Act stets berücksichtigt werden [16]. Verbraucher behalten zudem die Kontrolle darüber, welche Daten sie mit welchen Anbietern teilen möchten und zu welchem Zweck. Ein ausgewogener Zugang zu Mobilitätsdaten für Marktteilnehmer kann so unter klaren Bedingungen ermöglicht werden.
Die Einführung automatisierter Systeme zur Erfassung von Pendlerdaten erfordert eine gut durchdachte Herangehensweise. Mit digitalen Prozessen und klarer Transparenz können Unternehmen sowohl Kosten als auch Leistung effizienter verwalten und optimieren [17].
Der erste Schritt ist eine gründliche Analyse der bestehenden Daten- und Prozessabläufe. Ziel ist es, Effizienzpotenziale aufzudecken und die Produktivität zu steigern [17]. Dabei sollten Sie festlegen, welche Verkehrsmittel Ihrer Mitarbeitenden erfasst werden und welche Standorte und Emissionskategorien berücksichtigt werden sollen.
Ein interdisziplinäres Team ist essenziell. Dieses sollte Fachleute aus den Bereichen Nachhaltigkeit, HR, IT und Datenschutz umfassen. Regelmäßige Updates sorgen dafür, dass alle Beteiligten stets auf dem neuesten Stand sind [17]. Eine Gap-Analyse hilft dabei, bestehende Datenschutzmaßnahmen zu bewerten und Schwachstellen zu identifizieren [19].
Datenschutz sollte von Anfang an im Fokus stehen. Stellen Sie sicher, dass alle Prozesse den Vorgaben der DSGVO entsprechen. Interne Richtlinien zur Verarbeitung personenbezogener Daten geben dabei eine klare Orientierung. Mit diesen Grundlagen kann im nächsten Schritt die Auswahl der passenden digitalen Tools erfolgen.
Die Wahl der richtigen Tools ist entscheidend. Hierbei sollten Sie auf bewährte Beratung und erprobte Lösungen setzen, die eine erfolgreiche Implementierung unterstützen [17]. Ein Datenschutz-Managementsystem (DSMS) ist unverzichtbar, um personenbezogene Daten sicher und gesetzeskonform zu verwalten [19].
Ein gut strukturiertes DSMS basiert auf dem Plan-Do-Check-Act-Zyklus, der eine kontinuierliche Verbesserung ermöglicht [19]. Digitale Datenschutz-Software kann dabei helfen, Prozesse zu dokumentieren, zu automatisieren und zu überwachen [19].
Technische Maßnahmen wie Verschlüsselung, Zugriffskontrollen und Pseudonymisierung sind ebenfalls wichtig [19]. Nutzen Sie Data Mapping, um alle Datenverarbeitungsprozesse in Ihrer Organisation umfassend zu dokumentieren [19]. Transparenz ist dabei entscheidend: Geben Sie klare Informationen über die Nutzung von KI-Technologien, die Zwecke der Datenverarbeitung und die Rechte der Betroffenen [18]. Halten Sie sich an die Datenminimierungsprinzipien der DSGVO, indem Sie nur die wirklich notwendigen Informationen erheben [18].
Die Verantwortung für ein funktionierendes DSMS liegt bei der gesamten Organisation, wobei das Management die Hauptverantwortung trägt [19]. Regelmäßige Schulungen, die auf die Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen zugeschnitten sind, fördern das Bewusstsein für Datenschutz [19].
Kommunizieren Sie offen über den Zweck der Datenerfassung und die Vorteile für das Unternehmen und die Umwelt. Erklären Sie, wie die Daten genutzt werden und welche Rechte die Mitarbeitenden haben. Mehrsprachige und barrierefreie Materialien können dabei helfen, alle Mitarbeitenden einzubeziehen.
Ein Datenschutzbeauftragter sollte als zentraler Ansprechpartner für alle Fragen und Anliegen zur Verfügung stehen. Nach der Schulung und der internen Abstimmung ist es wichtig, die Qualität der gesammelten Daten kontinuierlich zu überprüfen.
Regelmäßige Audits helfen sicherzustellen, dass interne Richtlinien und gesetzliche Anforderungen eingehalten werden [19]. Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) sorgt dafür, dass das DSMS stets auf dem neuesten Stand bleibt [19].
Automatisierte Validierungsregeln können dabei helfen, Fehler in den Daten frühzeitig zu erkennen. Ergänzend dazu sollten Stichprobenkontrollen durchgeführt werden, um Ausreißer und unplausible Werte zu identifizieren.
Damit Entscheidungen schnell und fundiert getroffen werden können, benötigen Stakeholder Zugriff auf aussagekräftige Datenanalysen [17]. Dashboards mit Echtzeitvisualisierungen sind hierfür ein effektives Werkzeug.
Automatisierte Berichte, die den deutschen Berichtspflichten entsprechen, sind ein wichtiger Bestandteil der Datenerfassung. Visualisierungstools können dabei helfen, komplexe Pendlerdaten verständlich darzustellen. Diese Daten sind besonders relevant für die Erfüllung der Scope 3.7-Berichtspflichten und eine präzise Emissionsberichterstattung.
Trend-Analysen ermöglichen es, Entwicklungen über die Zeit zu beobachten und Verbesserungsmöglichkeiten bei den Pendleremissionen zu identifizieren. Besonders hilfreich sind Visualisierungen zu Modal-Split-Daten, CO₂-Emissionen nach Verkehrsmitteln und potenziellen Einsparungen.
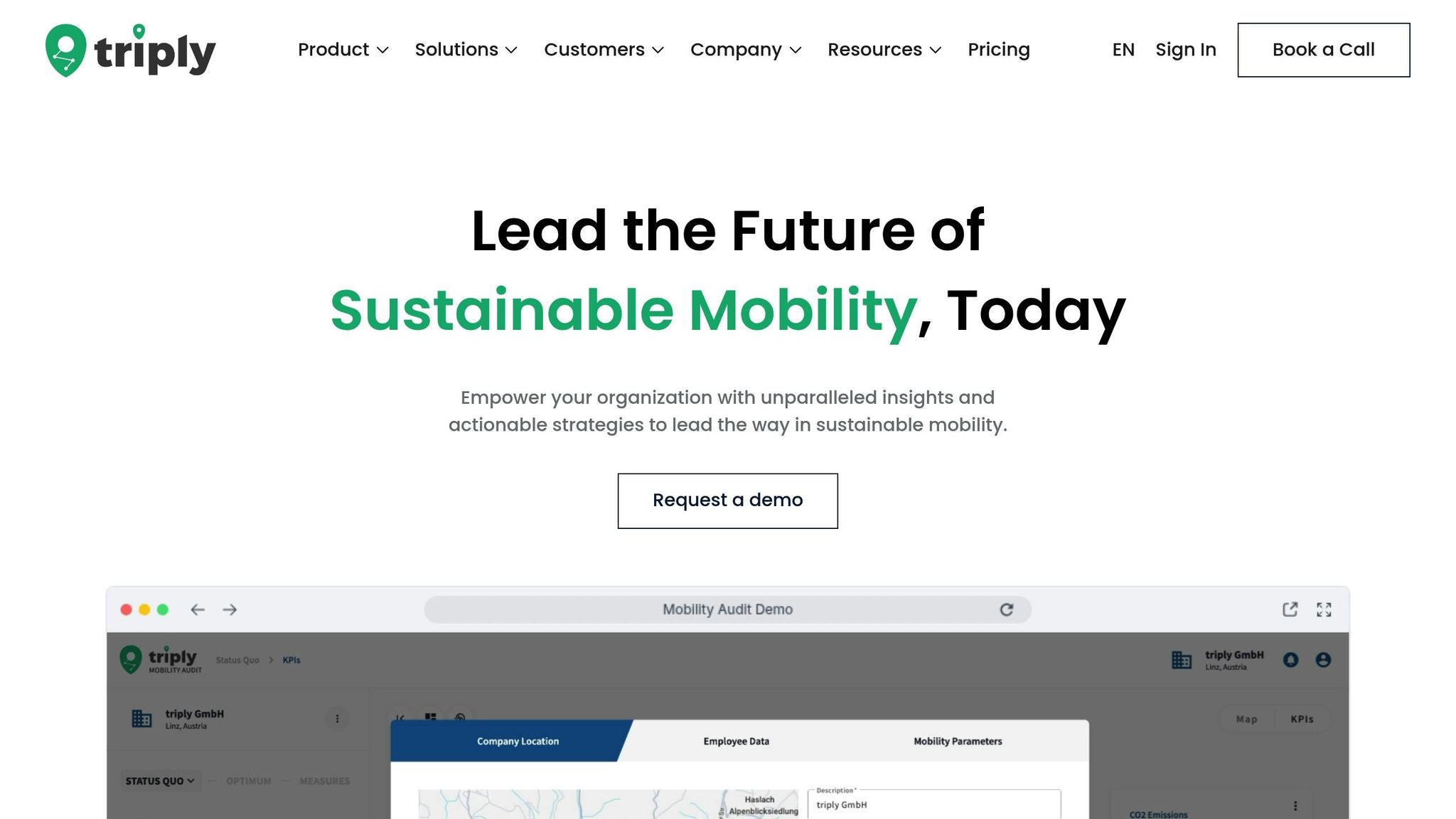
Basierend auf den zuvor beschriebenen Automatisierungslösungen bietet triply eine umfassende Plattform, die diese Prozesse noch effizienter gestaltet. Diese cloudbasierte SaaS-Lösung ermöglicht deutschen Unternehmen die automatisierte Erfassung von Pendlerdaten und eine präzise Scope 3.7-Emissionsberichterstattung. Damit wird nachhaltige Mobilitätsanalyse für Unternehmen jeder Größe zugänglich.
Die Plattform punktet mit erweiterten Analysefunktionen und individuell anpassbaren Dashboards, die speziell auf deutsche Standards ausgerichtet sind. Mit automatisierten CO₂-Berechnungen hilft triply Unternehmen dabei, ihre Berichtspflichten einfacher und schneller zu erfüllen. Das sogenannte triply Mobility Audit bietet eine detaillierte Übersicht über die Mobilitätsstrukturen eines Unternehmens. Dies hat bereits zahlreichen Organisationen geholfen, Kosten und Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Vorteile für Mitarbeitende zu erhöhen:
"Das triply Mobility Audit hat uns geholfen, unsere Mobilitätslandschaft besser zu verstehen und datenbasierte Maßnahmen zu ergreifen, um Kosten und Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Mitarbeitervorteile zu verbessern."
– Patrick Zinner, Nachhaltigkeitsmanager, Ringana [20][21]
Ein weiterer Vorteil der Plattform sind die integrierten Kosten-Nutzen-Analysen. Diese Analysen geben Unternehmen Einblicke in die wirtschaftlichen Auswirkungen nachhaltiger Mobilitätsentscheidungen. Interessanterweise berichten Unternehmen von einer bis zu 20 % höheren Mitarbeiterbindung durch die Nutzung solcher Maßnahmen [22]. Zusätzlich dokumentieren die Analyse- und Visualisierungstools von triply Fortschritte und erleichtern es, auf neue regulatorische Anforderungen zu reagieren. Dies ist besonders wichtig, da Scope 3.7-Emissionen oft bis zu 75 % der gesamten Scope 3-Emissionen eines Unternehmens ausmachen [22].
Die beschriebenen Funktionen bilden die Grundlage für eine einfache Integration in bestehende Systeme, auf die im nächsten Abschnitt eingegangen wird.
Die Plattform lässt sich problemlos in bestehende HR- und Fuhrparkmanagementsysteme integrieren und erfüllt dabei alle Anforderungen der DSGVO. Dabei werden sichere Datenübertragungen gewährleistet, und Datenverarbeitungsvereinbarungen gemäß Artikel 28 der DSGVO abgeschlossen. Um den manuellen Aufwand zu minimieren und Fehler zu vermeiden, setzt triply außerdem auf technische Maßnahmen zur Datensicherheit gemäß Artikel 32.
"Das triply Mobility Audit hat uns befähigt, unsere Mobilitätsstrategie kontinuierlich zu verfolgen und zu optimieren, was sowohl der Organisation als auch unseren Mitarbeitern zugute kommt."
– Christian Huter, Innovationsmanager, ÖAMTC [20][21]
Zusätzlich unterstützt triply Unternehmen bei Datenschutz-Folgenabschätzungen und führt regelmäßige Audits durch, um die Einhaltung der Compliance sicherzustellen.
Um den unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen gerecht zu werden, bietet triply flexible Preispläne, die auf verschiedene Größen und Bedürfnisse zugeschnitten sind:
| Plan | Zielgruppe | Hauptfunktionen | Besonderheiten |
|---|---|---|---|
| Basic | Kleine Organisationen | Erweiterte Analysen, Scope 3-Emissionsberichterstattung, grundlegende Dashboards | Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten |
| Professional | Mittelständische Unternehmen | Alle Basic-Funktionen, erweiterte Dashboards, Optimierung der Mitarbeitermobilität | Begrenzte Beratungsstunden |
| Enterprise | Große Organisationen | Alle Professional-Funktionen, vollständige Anpassung, Expertenberatung | Keine Einschränkungen |
Die Implementierung der triply-Lösung erfolgt zügig, was durch Kundenberichte untermauert wird. Hans-Jörg Preining von HYPO Oberösterreich beschreibt seine Erfahrung:
"Das triply Mobility Audit ist ein ausgezeichnetes Tool. Die Analyse dauerte weniger als eine Woche, und die Daten sind präzise und aufschlussreich. Mitarbeitermobilität ist ein großer Bereich, in dem Fehler gemacht werden können, aber triply hat uns geholfen, das zu vermeiden."
– Hans-Jörg Preining, Leiter Nachhaltigkeit & Wertpapiere, HYPO Oberösterreich [20][21]
Für deutsche Unternehmen ist besonders relevant, dass 76 % der Mitarbeitenden Mobilitätsleistungen wünschen [22]. Mit triply können diese Erwartungen erfüllt werden, während gleichzeitig die Anforderungen der Scope 3.7-Berichterstattung eingehalten werden.
Die Erfassung und Berichterstattung von Pendlerdaten wird für deutsche Unternehmen immer wichtiger, insbesondere angesichts der verschärften Umweltauflagen durch den EU Green Deal. Deutschland hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt: Bis 2045 soll Treibhausgasneutralität erreicht werden, und bis 2030 ist eine Reduktion der Emissionen um mindestens 65 % im Vergleich zu 1990 geplant [24].
Die aktuellen Zahlen zeigen jedoch deutliche Schwächen: Nur 9 % der Unternehmen erfassen Emissionen in allen relevanten Bereichen, während 86 % weiterhin auf manuell geführte Tabellen setzen [23]. Diese überholten und fehleranfälligen Methoden reichen nicht aus, um den wachsenden regulatorischen Anforderungen gerecht zu werden.
Digitale Tools wie triply bieten hier eine Lösung. Sie ermöglichen eine automatisierte Datenerfassung, die Integration verschiedener Datenquellen und fördern die Zusammenarbeit mit Partnern – alles essenzielle Elemente für eine präzise Erfassung von Scope-3-Daten [23]. Solche Plattformen liefern nicht nur Echtzeit-Daten, sondern auch individuell anpassbare Dashboards, die Unternehmen bei strategischen Entscheidungen unterstützen.
"Eines der wichtigsten Maße für Plan A ist die Zeit bis zur Aktion, Zeit bis zum Bericht, Zeit bis zum Datenupload. Das sind sehr operative Kennzahlen für die Effizienz eines Nachhaltigkeitsteams. Wenn dieses Team die Zeit für einen vollständigen Bericht um das 80-fache reduzieren kann, hat es entsprechend mehr Zeit für die Strategieentwicklung rund um diese Daten." – Nathan Bonnisseau, Mitgründer bei Plan A [23]
Die Automatisierung und digitale Transformation sind entscheidend für die Weiterentwicklung der Scope-3.7-Berichterstattung. Unternehmen, die frühzeitig in solche Technologien investieren, sichern sich nicht nur Vorteile bei der Einhaltung von Vorschriften, sondern können auch ihre Nachhaltigkeitsziele schneller und effizienter erreichen. Mit Deutschlands Fokus auf digitale Souveränität und Datenschutz bieten Plattformen wie triply die notwendige Sicherheit und Unterstützung, um eine zukunftssichere und regelkonforme Emissionsberichterstattung zu gewährleisten.
Die automatisierte Erfassung von Pendlerdaten bringt Unternehmen erhebliche Vorteile, insbesondere wenn es um die Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten geht. Durch diese Technologie stehen präzise und stets aktuelle Daten zur Verfügung, die eine genauere Berechnung der Scope-3-Emissionen ermöglichen. Gleichzeitig wird der manuelle Aufwand erheblich reduziert, was nicht nur Zeit spart, sondern auch das Risiko von Fehlern minimiert.
Ein weiterer Pluspunkt: Automatisierte Systeme erleichtern die detaillierte Analyse von Emissionsdaten. Das führt zu mehr Transparenz und stärkt das Vertrauen in die Berichte. Unternehmen können so ihre Fortschritte bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen besser dokumentieren und belegen. Insgesamt macht diese Methode die Berichterstattung nicht nur effizienter, sondern auch moderner und zuverlässiger.