Immer mehr Unternehmen setzen auf ÖPNV statt Firmenwagen. Erfahren Sie, wie der Umstieg gelingt und welche Vorteile er bietet.

Firmenwagen adé – ÖPNV willkommen! Immer mehr Unternehmen in Deutschland setzen auf öffentliche Verkehrsmittel, um Kosten zu senken, die Umwelt zu entlasten und Mitarbeitende zufriedener zu machen. Doch wie gelingt der Wechsel? Hier sind die wichtigsten Punkte:
Mit Tools wie triply können Unternehmen Pendelgewohnheiten analysieren, Maßnahmen planen und Fortschritte messen. Der Umstieg erfordert Planung, bietet aber klare Vorteile für Unternehmen und Mitarbeitende.
In Deutschland gibt es klare steuerliche Regelungen und attraktive Fördermöglichkeiten, die Unternehmen bei der Einführung von ÖPNV-Programmen unterstützen. Diese Rahmenbedingungen bieten sowohl Arbeitgebern als auch Arbeitnehmern finanzielle Vorteile und erleichtern die Umsetzung solcher Programme. Im Folgenden werden die wichtigsten Aspekte beleuchtet.
Unternehmen können ihren Mitarbeitenden Zuschüsse für das Deutschlandticket oder andere ÖPNV-Tickets bis zur vollen Höhe des Kaufpreises steuer- und sozialversicherungsfrei gewähren – vorausgesetzt, diese Zuschüsse erfolgen zusätzlich zum Gehalt[1]. Alternativ können Arbeitgeber die Zuschüsse pauschal mit 25 Prozent versteuern, was ebenfalls steuer- und sozialversicherungsfreie Leistungen ermöglicht[1].
Das Deutschlandticket wird als Jobticket besonders attraktiv, wenn der Arbeitgeber mindestens 25 Prozent des Ticketpreises übernimmt. Ab Januar 2025 entspricht dies einem Mindestbeitrag von 14,50 Euro, wodurch Mitarbeitende nur noch 46,55 Euro monatlich zahlen[1]. Mehr als die Hälfte der großen deutschen Unternehmen bietet das Deutschlandticket bereits als Jobticket an[2].
Wichtig: Steuerfreie Sachbezüge müssen in der Lohnbuchhaltung dokumentiert und in der Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden. Zudem sind Belege für die Fahrkarten aufzubewahren[2].
Neben Zuschüssen spielen steuerliche Pauschalen eine wichtige Rolle bei der Entlastung von Pendlern. Die Pendlerpauschale ermöglicht es, die Kosten für den Arbeitsweg steuerlich geltend zu machen – unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel[3]. Sie gilt ab dem ersten Kilometer der einfachen Entfernung und weist folgende Sätze auf:
| Zeitraum | Betrag pro km (1.-20. km) | Betrag pro km (ab 21. km) |
|---|---|---|
| 2024 | 0,30 € | 0,38 € |
| 2025 | 0,30 € | 0,38 € |
| 2026 | 0,30 € | 0,38 € |
Das Finanzamt rechnet in der Regel mit 230 Arbeitstagen pro Jahr bei einer 5-Tage-Woche bzw. 280 Tagen bei einer 6-Tage-Woche[3]. Die maximale Absetzbarkeit liegt bei 4.500 Euro jährlich[3].
Ein wichtiger Punkt: Steuerfreie ÖPNV-Leistungen mindern den absetzbaren Betrag der Pendlerpauschale[2]. Für Fernpendler kann es vorteilhaft sein, die Pendlerpauschale als Freibetrag beim Finanzamt zu beantragen, um die Entlastung direkt im Nettogehalt zu spüren[3].
Die finanziellen Unterschiede zwischen Firmenwagen und ÖPNV-Leistungen sind erheblich. Firmenwagen verursachen hohe Kosten durch Leasingraten, Versicherungen und Wartung. Ein Mobilitätsbudget hingegen verzichtet auf solche Fixkosten und bietet Unternehmen eine kostengünstigere Alternative[5].
Firmenwagen in Deutschland haben durchschnittlich eine höhere Motorleistung (160 PS) als private Fahrzeuge (115 PS) und legen jährlich etwa 30.000 km zurück[4][6]. Die steuerlichen Vorteile der privaten Firmenwagennutzung belasten den Staat jährlich mit geschätzten drei bis sechs Milliarden Euro[6].
"Die derzeitigen Regelungen spiegeln die tatsächlichen finanziellen Vorteile bei weitem nicht wider. Außerdem sind die Autos oft mit einer Firmenkraftstoffkarte ausgestattet, die als Pauschale funktioniert: Je mehr ich fahre, desto mehr spare ich."
– Konstantin Kreye, Öko-Institut[6]
Im Vergleich dazu sind die Kosten für ÖPNV-Programme überschaubar. Das Deutschlandticket kostet aktuell 49 Euro pro Monat und steigt ab Januar 2025 auf 58 Euro[1]. Selbst bei voller Kostenübernahme durch den Arbeitgeber belaufen sich die jährlichen Ausgaben pro Mitarbeitendem auf maximal 696 Euro – deutlich weniger als die Kosten eines Firmenwagens.
Auch steuerlich ist der Vorteil klar: Während Firmenwagen durch die 1-Prozent-Regelung einen geldwerten Vorteil darstellen, bleiben ÖPNV-Zuschüsse bis zu 50 Euro monatlich komplett steuerfrei. Für höhere Beträge gilt ein reduzierter Steuersatz von 25 Prozent[1].
Unternehmen können hybride Modelle nutzen, indem sie die Firmenwagenflotte reduzieren und ein Mobilitätsbudget einführen. Dieses Budget kann die eingesparten Kosten widerspiegeln und die Vorteile beider Systeme kombinieren – bei gleichzeitig geringerem Verwaltungsaufwand[5]. So wird der Wechsel vom Firmenwagen hin zu ÖPNV-Leistungen für Unternehmen und Mitarbeitende gleichermaßen attraktiv.
Der Umstieg vom Firmenwagen auf den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) erfordert eine gut durchdachte Planung, die sowohl die Bedürfnisse der Mitarbeitenden als auch die Ziele des Unternehmens berücksichtigt.
Der erste Schritt besteht darin, die aktuellen Pendelgewohnheiten der Mitarbeitenden zu analysieren. Unternehmen sollten Daten zu Arbeitswegen sammeln und auswerten, um herauszufinden, wie viele Mitarbeitende bereits den ÖPNV nutzen und wo es Möglichkeiten zur Optimierung gibt.
Mit modernen Tools wie triply lassen sich Mobilitätsdaten detailliert visualisieren. Solche Analysen helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen der ÖPNV besonders sinnvoll eingesetzt werden kann, und liefern eine datenbasierte Grundlage für weitere Entscheidungen.
Dabei sollten Faktoren wie die Entfernung zum Arbeitsplatz, genutzte Verkehrsmittel, Arbeitszeiten und spezielle berufliche Anforderungen berücksichtigt werden. Diese Informationen sind entscheidend, um passende ÖPNV-Lösungen zu wählen und gezielt zu fördern.
Nach der Analyse der Mobilitätsdaten folgt die Auswahl geeigneter ÖPNV-Angebote. Eine attraktive Option ist das Deutschlandticket, das für 58 Euro pro Monat unbegrenzte Fahrten mit regionalen und lokalen Verkehrsmitteln in ganz Deutschland ermöglicht[8].
Unternehmen können ihren Mitarbeitenden einen ÖPNV-Zuschuss anbieten, der steuer- und sozialversicherungsfrei ist[7]. Diese Lösung ist unabhängig von der Unternehmensgröße und bietet mehr Flexibilität als klassische Jobtickets, da der Verwaltungsaufwand geringer ist[7].
Zudem gibt es zwei Modelle zur Finanzierung: einen zusätzlichen Zuschuss oder eine Gehaltsumwandlung[7]. Ein zusätzlicher Zuschuss ist für beide Seiten – Unternehmen und Mitarbeitende – oft finanziell vorteilhafter. Mitarbeitende profitieren dabei von maximaler Flexibilität, da sie das Ticket wählen können, das ihren individuellen Bedürfnissen am besten entspricht[7].
Darüber hinaus fördern staatliche Programme emissionsfreie Mobilitätslösungen mit Zuschüssen von bis zu 80 Prozent[9].
Damit ein ÖPNV-Programm erfolgreich ist, braucht es eine klare und überzeugende Kommunikationsstrategie. Die Vorteile – wie finanzielle Ersparnisse, weniger Stress und ein Beitrag zum Umweltschutz – sollten deutlich hervorgehoben werden.
Ein Beispiel für den Erfolg solcher Maßnahmen: Im Jahr 2018 führte das Land Hessen ein kostenloses ÖPNV-Ticket für rund 145.000 Landesbedienstete ein, darunter auch Universitätsmitarbeitende[10]. Eine Umfrage an der Goethe-Universität Frankfurt zeigte, dass die Nutzung des ÖPNV für Arbeitswege nach Einführung des Tickets deutlich anstieg[10].
Das betriebliche Mobilitätsmanagement spielt dabei eine zentrale Rolle. Es hilft Unternehmen, das Mobilitätsverhalten der Mitarbeitenden zu lenken und nachhaltige Strukturen zu schaffen[11]. Digitale Services und integrierte Jobticket-Lösungen können diesen Prozess zusätzlich erleichtern[11].
Für eine erfolgreiche Umsetzung empfiehlt es sich, mit Pilotprojekten zu starten. Freiwillige Mitarbeitende können die neuen Maßnahmen testen, wodurch Unternehmen wertvolle Erkenntnisse gewinnen und mögliche Probleme frühzeitig erkennen können. Klare Zeitpläne, regelmäßiges Feedback und eine schrittweise Einführung fördern die Akzeptanz und den Erfolg der Maßnahmen.
Der Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel (ÖPNV) ist ein Prozess, der eine systematische Erfassung und Analyse von Daten erfordert, um langfristig Wirkung zu zeigen.
Die Erfolgsmessung basiert auf zentralen Leistungsindikatoren, die Umwelt-, sozioökonomische und verkehrsbezogene Aspekte einbeziehen [12]. Unternehmen sollten sich dabei auf die Kennzahlen konzentrieren, die ihren spezifischen Zielen und Rahmenbedingungen entsprechen.
Ein zentraler Indikator ist der Modal Split, der das Verhältnis der von Mitarbeitenden genutzten Verkehrsmittel erfasst. Er zeigt, inwiefern die Förderung des ÖPNV angenommen wird. Ebenso wichtig ist die CO₂-Reduktion: Im Verkehrssektor haben sich die Emissionen in Deutschland seit 1990 kaum verändert, wobei Pkw, Lkw und Busse 96 % der inländischen Verkehrsemissionen ausmachen [13]. Weitere relevante Kennzahlen sind die Kosten pro Mitarbeitendem, die Nutzungshäufigkeit von ÖPNV-Angeboten, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden und die Verringerung der Parkplatznutzung.
Diese Daten bilden die Grundlage für detaillierte Analysen, die mit Tools wie triply durchgeführt werden können.
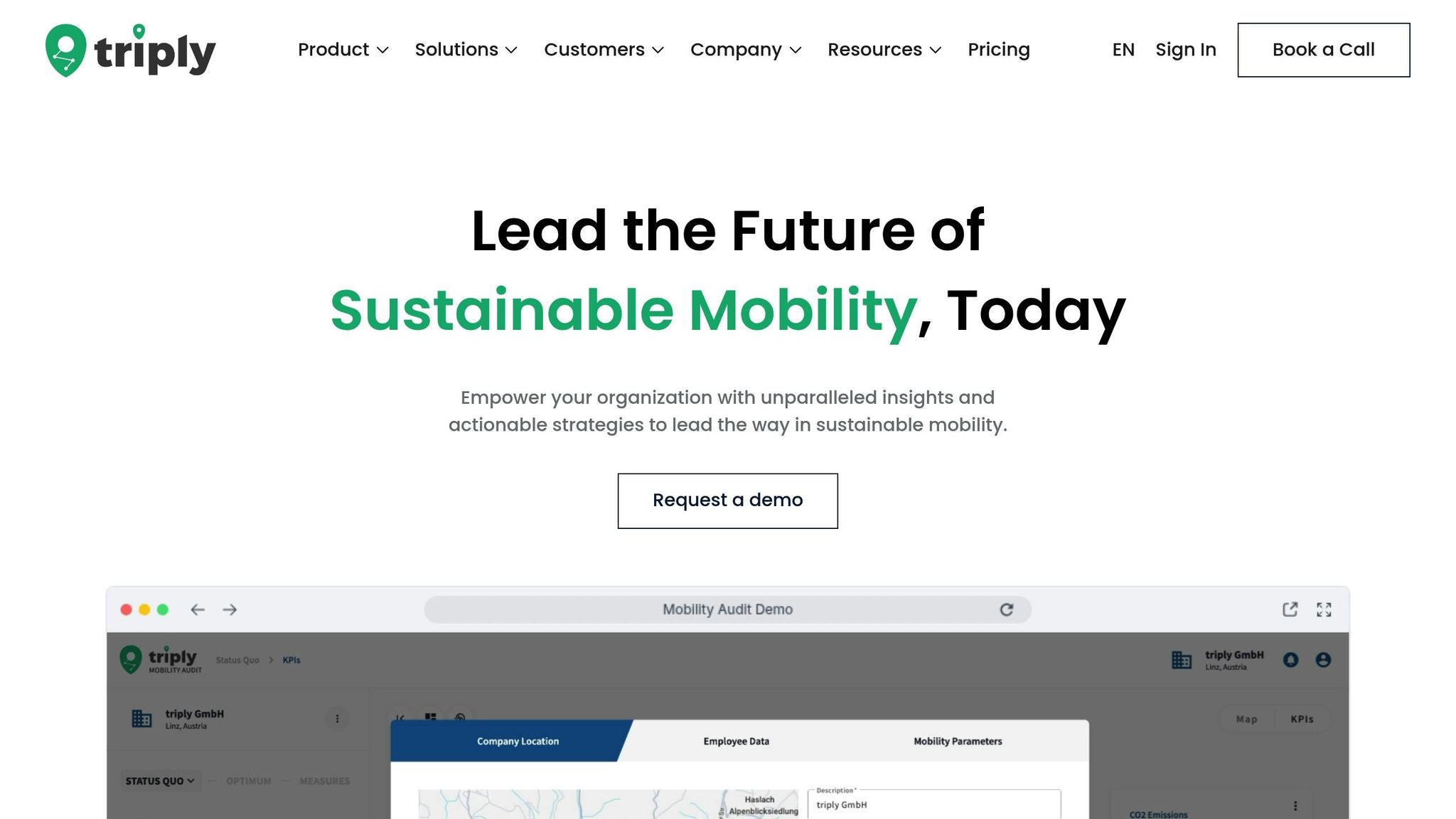
Mit triply erhalten Unternehmen Werkzeuge, um ihre Mobilitätsstrategien datenbasiert zu optimieren. Das Tool hilft, Herausforderungen in Chancen zu verwandeln, Kosten zu reduzieren und gleichzeitig Umweltziele zu erreichen [15].
Ein Beispiel hierfür liefert Patrick Zinner, Sustainability Manager bei Ringana. Er erklärt:
"Das triply Mobility Audit half uns dabei, unsere Mobilitätslandschaft besser zu verstehen und datenbasierte Maßnahmen zu ergreifen, um Kosten und Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Mitarbeitervorteile zu verbessern."
Die anpassbaren Dashboards von triply ermöglichen tiefgehende Einblicke und eine intuitive Visualisierung von Fortschritten in Sachen Nachhaltigkeit [14]. Neben der Analyse von Kernkennzahlen unterstützt das Tool auch die Erfassung indirekter Emissionen.
Scope-3-Emissionen umfassen alle indirekten Emissionen, die durch Aktivitäten entstehen, die nicht direkt im Besitz oder unter der Kontrolle eines Unternehmens stehen, aber dessen Wertschöpfungskette beeinflussen [16]. Dazu zählt auch der Arbeitsweg der Mitarbeitenden [16][19].
Eine präzise Berichterstattung über Scope-3-Emissionen ist essenziell, um Umweltziele zu erreichen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen [17]. Schließlich machen die Emissionen aus der Lieferkette oft den Großteil der gesamten Treibhausgasemissionen eines Unternehmens aus [16].
triply bietet exakte Tools zur Erfassung von Scope-3-Emissionen und unterstützt Unternehmen dabei, Mobilitätsprogramme zu entwickeln, die nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll sind [14][15]. Durch eine regelmäßige Überprüfung relevanter Kennzahlen – idealerweise vierteljährlich – können Unternehmen ihre Fortschritte bei der Umstellung auf nachhaltige Mobilität überwachen und ihre Strategien gezielt anpassen [18].
Basierend auf einer genauen Analyse der Mobilitätsdaten zeigt sich, wie eine nachhaltige Mobilitätskultur etabliert werden kann. Der erfolgreiche Wechsel zum öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) erfordert langfristige, nicht-monetäre Ansätze, die das Verhalten der Mitarbeitenden dauerhaft beeinflussen. Hier sind einige konkrete Maßnahmen, mit denen Unternehmen diesen Wandel aktiv unterstützen können.
Belohnungssysteme schaffen Anreize für Mitarbeitende, die sich für nachhaltige, geteilte oder aktive Transportmethoden entscheiden[20]. Durch positive Verstärkung wird dieses Verhalten gefestigt[20].
Gamification nutzt den natürlichen Wettbewerbsgeist und stärkt das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Belegschaft[22]. Sofortiges Feedback und klare Belohnungen erhöhen die Motivation. Flexible Programme, die sich an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden anpassen, fördern die Akzeptanz[20][22].
Ein Beispiel ist das "Bella Mossa"-Programm in Bologna, Italien. Hier konnten Bürgerinnen und Bürger über eine App Punkte für nachhaltiges Reisen sammeln, die sie gegen Belohnungen wie Eis oder Kinokarten eintauschen konnten. Das Programm führte zu einer deutlichen Zunahme nachhaltiger Pendelwege[22]. Ähnlich funktioniert die BetterPoints-Plattform in Großbritannien, bei der Punkte für umweltfreundliches Pendeln in Gutscheine, Spenden oder andere Vorteile umgewandelt werden können[22].
Konkret könnten Unternehmen Rabatte, Geschenkgutscheine oder zusätzliche Freizeit anbieten. Auch Abzeichen oder Bestenlisten können als Anerkennung dienen[20]. Freundschaftliche Wettbewerbe, wie Team-Challenges beim Fahrradfahren oder Fahrgemeinschaften, sorgen für zusätzlichen Ansporn[21].
In Deutschland spielen Transparenz und direkte Kommunikation eine zentrale Rolle[24]. Mitarbeitende schätzen klar definierte Erwartungen und transparente Prozesse[24].
Eine gründliche Vorbereitung, die das Sammeln und Auswerten relevanter Daten umfasst, bildet die Grundlage für erfolgreiche Bewertungen. Diese sollten sowohl positive Rückmeldungen als auch konkrete Verbesserungsvorschläge enthalten und durch Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung ergänzt werden[24].
Eine Feedback-Schleife mit Mitarbeitenden, die bereits auf den ÖPNV umgestiegen sind, bietet wertvolle Einblicke. Ihre Erfahrungen können genutzt werden, um Mobilitätsrichtlinien kontinuierlich zu verbessern[25]. Unternehmen sollten aktiv Feedback einholen und zeigen, dass die Meinungen der Mitarbeitenden geschätzt werden[24].
"Die deutsche Arbeitskultur betont Transparenz und Mitarbeiterbeteiligung, was es für einen internationalen Arbeitgeber wichtig macht, den Prozess mit dem richtigen kulturellen Verständnis anzugehen."
– Lea Orellana-Negrin, Recruiterin, Eurojob-Consulting[24]
Eine respektvolle und klare Kommunikation ist essenziell. Konkrete Beispiele, das Erfragen von Karrierezielen und das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten stärken das Vertrauen. Diese Rückmeldungen liefern zudem wichtige Impulse für datenbasierte Anpassungen der Programme.
Datengestützte Plattformen ermöglichen es, Programme kontinuierlich zu verbessern und Anreize individuell anzupassen, um ihre Wirksamkeit langfristig zu steigern[22]. So bietet beispielsweise triply detaillierte Einblicke in Pendelverhalten durch anschauliche Visualisierungen und Analysen.
Erfolgreiche Programme nutzen interne Kommunikationskanäle wie Poster oder Newsletter, um Mitarbeitende zu informieren[20]. Statistiken, die Nennung von Spitzenleistern oder das Verteilen von Preisen fördern zusätzlich die Motivation. Studien zeigen, dass 74 % der Verbraucher bereit sind, sich für Treuepunkte mehr anzustrengen[23].
Die Analyse der Mobilitätsdaten hilft, Verhaltensmuster zu erkennen und Anreizsysteme zu optimieren. So können Unternehmen sicherstellen, dass ihre Mobilitätsprogramme sowohl umweltfreundlich als auch wirtschaftlich effektiv bleiben.
Der Wechsel vom Dienstwagen hin zu öffentlichen Verkehrsmitteln erfordert eine durchdachte Strategie. Dazu gehören die Analyse der aktuellen Situation, die Definition konkreter Ziele (wie CO₂-Reduktion oder Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit) und eine offene Kommunikation der Vorteile [26]. Eine umfassende Mobilitätsrichtlinie, die sowohl die Bedürfnisse der Mitarbeitenden berücksichtigt als auch umweltfreundliche Optionen fördert, ist ein zentraler Baustein dieses Wandels [26]. Diese strategische Herangehensweise zeigt sich auch in der Praxis.
Niedrige langfristige Nutzungsraten machen deutlich, wie wichtig regelmäßige Evaluierungen sind [29]. Unternehmen, die Mobilität in den Fokus rücken, profitieren zudem von gesteigerter Agilität und Wettbewerbsfähigkeit. Interne Versetzungen erweisen sich oft als kostengünstiger und schneller umsetzbar im Vergleich zu externen Neueinstellungen [28].
Der Nutzen datenbasierter Analysen wird von Experten hervorgehoben. Patrick Zinner von Ringana erklärt hierzu:
„Das triply Mobility Audit hat uns geholfen, unsere Mobilitätslandschaft besser zu verstehen und datenbasierte Maßnahmen zu ergreifen, um Kosten und Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig die Mitarbeitervorteile zu verbessern." [14]
Auch Hans-Jörg Preining von HYPO Oberösterreich hebt die Effizienz der Analyse hervor, die innerhalb weniger Tage präzise Ergebnisse lieferte [14].
Erfolgreiche Mobilitätsprogramme setzen klare rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Anreize und gezielte Maßnahmen zur Verhaltensänderung voraus [26]. Eine kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Mobilitätsrichtlinien stellt sicher, dass sie sowohl den Bedürfnissen der Mitarbeitenden als auch den Unternehmenszielen entsprechen [26]. Multimodale Mobilität wird dabei immer attraktiver – ein durchdachtes Mitarbeitermobilitätsmanagement kann somit entscheidend zum Wandel beitragen [27]. Mit diesem Ansatz verbessern Unternehmen nicht nur ihre CO₂-Bilanz, sondern stärken auch ihre Position im Wettbewerb [27].
Der Wechsel zum öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) kann für Unternehmen und Mitarbeitende nicht nur umweltfreundlich, sondern auch finanziell lohnend sein. Besonders attraktiv sind die steuerlichen Vorteile, die sich durch Arbeitgeberzuschüsse ergeben. Ein Beispiel: Das Deutschlandticket als Jobticket kann für Mitarbeitende bis zu 100 % steuer- und sozialversicherungsfrei angeboten werden (§ 3 Nr. 15 EStG).
Es gibt jedoch eine wichtige Einschränkung: Wird das Ticket im Rahmen einer Gehaltsumwandlung finanziert, entfällt die Steuerfreiheit. In diesem Fall bleibt aber die Möglichkeit einer pauschalen Versteuerung mit 15 % oder 25 %, was weiterhin eine interessante Option darstellt.
Zusätzlich profitieren Mitarbeitende von der Fahrtkostenpauschale. Für die einfache Pendelstrecke können 0,30 € pro Kilometer in der Steuererklärung angesetzt werden. Damit wird der Umstieg auf den ÖPNV nicht nur ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, sondern auch eine spürbare finanzielle Entlastung.
Unternehmen können mehr über die Mobilitätsgewohnheiten ihrer Mitarbeitenden erfahren, indem sie Daten zu den Arbeitswegen sammeln. Das kann durch Umfragen oder die Nutzung von Geodaten geschehen. Solche Informationen liefern Einblicke in Pendelstrecken, -zeiten und bevorzugte Verkehrsmittel.
Mit diesen Erkenntnissen lassen sich konkrete Maßnahmen entwickeln. Beispiele sind Mobilitätsbudgets, Anreize für umweltfreundliches Pendeln oder digitale Nudging-Strategien. Solche Ansätze erleichtern den Wechsel zum ÖPNV und fördern langfristig nachhaltigere Verhaltensweisen.
Damit der Wechsel vom Firmenwagen auf den öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) gelingt, sollten Unternehmen zunächst die geltenden rechtlichen und steuerlichen Vorgaben in Deutschland prüfen. Ein Beispiel hierfür ist die 1-%-Regelung für Firmenwagen. Gleichzeitig können finanzielle Anreize, wie Zuschüsse für ÖPNV-Tickets oder die Einführung von Jobtickets, dazu beitragen, die Akzeptanz bei den Mitarbeitenden zu steigern.
Ein weiterer zentraler Punkt ist die Information und Einbindung der Mitarbeitenden. Mit gezielten Informationskampagnen und Schulungen lassen sich die Vorteile des ÖPNV sowie die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten besser vermitteln. Um den Übergang zu erleichtern, könnten Unternehmen auch vergünstigte oder kostenlose Tickets anbieten – ähnlich dem früheren 9-Euro-Ticket.
Zusätzlich sollten Mitarbeitende aktiv unterstützt werden. Dies könnte durch Kooperationen mit Verkehrsunternehmen, die Bereitstellung von Fahrplänen oder die Empfehlung praktischer Apps geschehen. Solche Maßnahmen machen den Umstieg nicht nur einfacher, sondern fördern auch eine langfristig nachhaltige Mobilität.